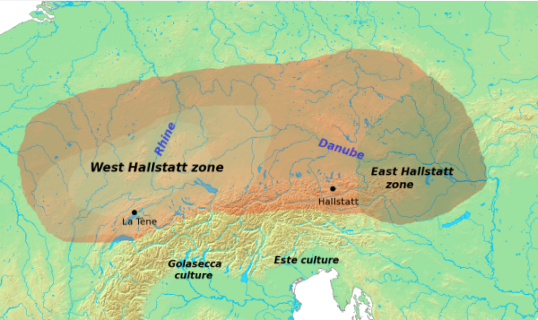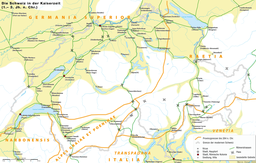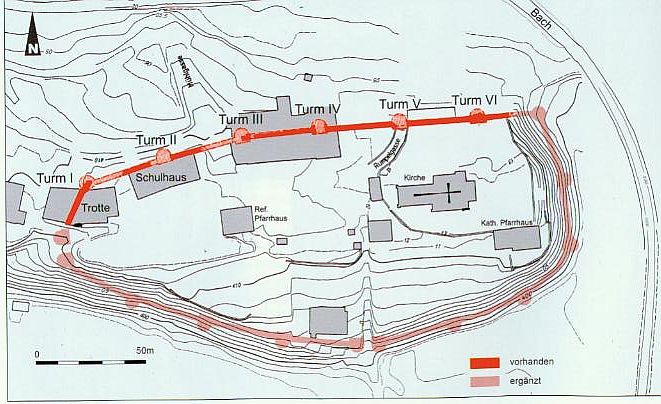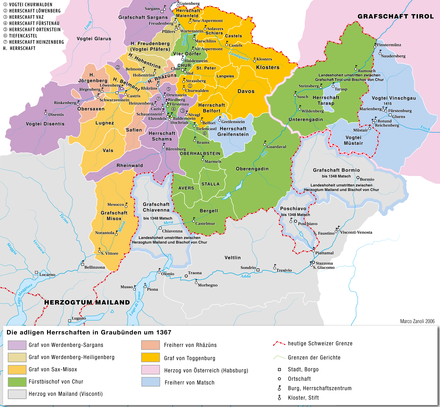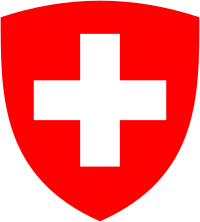Die Geschichte der Schweiz im Sinne eines souveränen Staates begann mit der Annahme der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Jahr 1848. Vorläufer waren die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts als lockerer Bund organisierte Alte Eidgenossenschaft, die zwischen 1798 und 1803 bestehende zentralistisch aufgebaute Helvetische Republik sowie die 1803 gegründete und 1815 neu organisierte «Schweizerische Eidgenossenschaft». Die eidgenössischen Kantone gewannen 1648 im Westfälischen Frieden die Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich (Deutscher Nation). Diese Souveränität wurde 1815 am Wiener Kongress erneut bestätigt, der bis auf geringe Abweichungen die heutigen Grenzen der Schweiz anerkannte.
Als Grundlinien der Schweizer Geschichte werden vielfach der ausgeprägte Föderalismus, das Demokratieverständnis und seit dem 16. Jahrhundert die Neutralität sowie die Vernetzung als Finanzplatz betrachtet, hinzu kommt die Idee der Alpenfestung. Hierum sind zahlreiche politische Mythen entstanden, die bis in die Gegenwart die Mentalität der Schweizer überaus stark beeinflussen.
Während im Mittelmeerraum die ältesten menschlichen Spuren bis zu 1,4 Millionen Jahre zurückreichen, ist das älteste Werkzeug, das in er Schweiz entdeckt wurde, höchstens 400.000 Jahre alt. Solche Faustkeile hinterließen auch die vor grob gesagt 100.000 Jahren auf Schweizer Gebiet erscheinenden Neandertaler. Doch die meisten Fundstätten stammen aus den vielleicht 10.000 Jahren vor ihrem Verschwinden, einer Zeit, als die meisten Gebiete der Schweiz unter Gletschern lagen. Im Gegensatz zu diesen Menschen, die Großwildjäger waren und etwa Mammuten nachstelllten, und von denen in der Schweiz nur ein Unterkiefer und ein Zahn übrigblieben, waren unsere unmittelbaren Vorfahren, die aus Afrika kommenden, anatomisch modernen Menschen, eher Rentierjäger, die vor etwa 45.000 Jahren Europa, zehn Jahrtausende später die Schweiz erreichten. In der Schweiz dürften sie den Neandertalern nie begegnet sein. Die Spuren der frühen Zuwanderer wurden von den Gletschern der Kaltzeiten vernichtet, so dass ihre regelmäßige Anwesenheit erst ab etwa 20.000 vor heute belegt ist, als die Gletscher begannen, sich zurückzuziehen. Mit den steigenden Temperaturen wichen die Rentiere nach Norden aus, die Menschen, die blieben, mussten sich auf Kleintierjagd umstellen, erbeuteten aber auch Steinbock, Hirsch, Reh und Pferd. Anders als in Frankreich und Spanien bestand keine vergleichbare Höhlenmalerei, sondern nur künstlerische Äußerungen auf kleineren Artefakten und Knochen; auch sind die Kleinstatuetten kopflos. Kulturelle Einflüsse von außerhalb folgten spätestens zu dieser Zeit den Flüssen, vor allem Rhein und Rhone. Pfeil und Bogen sowie Harpunen werden zu gängigen Jagd- und Fischgeräten, erstmals lassen sich Zelte oder Hütten nachweisen, menschliche Spuren fanden sich in über 2000 m Höhe. Tauschkontakte reichten bis in die Gegend von Paris, die frühen Bauern untrhielten entsprechende Kontakte bis zum Balkan.
Nach Ansätzen bei Jägern und Sammlern um 6500 v. Chr. setzte sich ab etwa 4500 eine frühe Bauernwirtschaft durch, die aus einer westlichen Hirten- und einer östlichen Landbauernkultur hervorgegangen war. Die berühmten Pfahlbauten sind aus der Zeit um 3700 v. Chr. überliefert, entsprechende Häuser bestanden bereits mehr als 500 Jahre früher. Das Beil ermöglichte den Hausbau, der besonders in der Bandkeramik kurz vor 5000 v. Chr. mit den Langhäusern gewaltige Dimensionen erreichte. Ab etwa 3500 v. Chr. können wir mit größeren Feldern rechnen.

Wenn man im Mittelmeerraum ähnlich hohe Berge antreffen will, wie in den Westalpen, dann muss man im Süden zum Hohen Atlas, im Osten gar bis zum Kaukasus gehen. Daher dürften die Kontakte über die Pässe großen Aufwand erfordert haben, wenn sie auch, wie der Ötzi belegt, nicht unüberwindlich waren. Schon in der frühesten Keramik unterscheiden sich, wohl aufgrund der schwierigen Verkehrsverhältnisse, Süd-, West- und Ostschweiz erheblich, jedoch variieren dabei die Übergangsgebiete. Die Kulturkontakte bestanden Richtung Donau, bis Südfrankreich und nach Oberitalien. Es entstanden Feuersteinminen, wobei Spitzensilex auch vom Gardasee oder aus Westfrankreich stammen konnte. Zu diesem Tauschobjekt kam um 3800 v. Chr. das Kupferbeil, bereits um 4500 v. Chr. Kalkröhrenperlen - Handelspfade lassen sich um 3500 belegen, wobei Boote dominierten - das älteste Schweizer Boot ist etwa 6.500 Jahre alt (Einbaum vom Moossee). Auch wurde um 4000 v. Chr. Wolle gewebt, ab etwa 3400 v Chr. vorrangig Schafwolle. Menhire gibt es hingegen nur in der Westschweiz, daneben fanden sich Dolmen an vielen Stellen. Wahrscheinlich wurden Tiere als Bauopfer getötet. Zuwanderungen lassen sich nur schwer fassen, möglicherweise wurden die frühen Bauern Mitte des 3. Jahrtausends durch spätere Zuwanderer weitgehend verdrängt - dazu passen Belege für kriegerische Auseinandersetzungen. Die Anlage von Lebensmittelvorräten gilt als Anzeichen einer langsam hierarchischer werden Gesellschaft, ein Trend, den die Verfügung über das Kupfer vielleicht verstärkte. Ab Mitte des 5. Jahrtausends lassen sich mehrere Kulturen auf dem Gebiet der Schweiz nachweisen, die sich deutlich voneinander unterschieden, und in denen sich enge Beziehungen Richtung Norden, Westen und Süden niederschlagen. So läasst sich etwa im Norden zwischen 3400 und 2800 v. Chr. die Horgener Kultur im Süden Baen-Württembergs und in der Schweiz nachweisen. Ob es sich bei diesen kulturellen Gruppen um ethnische Gruppen handelte, ist unklar.
In der Bronzezei, die sich von 2200 bis 800 v. Chr. erstreckte, fand ab 1450 v. Chr. eine Klimaverschlechterung statt. So mussten viele Siedlungen an den Seen wegen des steigenden Wasserstandes aufgegeben werden, und die Gletscher dehnten sich talwärts aus, während im Einzugsgebiet des Po große Trockenheit herrschte. Ein weiterer Vorstoß der Gletscher fand um 1200-1100 statt, erneut um 750 v. Chr. Trotz deiser Rückschläge entstanden nun größere Siedlungen von 1 bis 2 ha Fläche. Einige Siedlungen dienten anscheinend eher der Versorgung, andere deutlich der Verteidigung. An den Mittellandseen begannen erst um 1060 v. Chr. neue Bautätigkeiten.
Inzwischen waren Hierarchien zwischen den Dörfern entstanden, einige von ihnen wurden von Dörfern der Umgebung mitversorgt. In einigen Gebieten scheint eine Art Oberschicht entstanden zu sein. Am Ende der Bronzezeit lösten Bronzewerkzeuge die steinernen Werkzeuge zunehmend ab, eine Bronzegießerei bestand fast in jedem Dorf. Wanderweidewirtschaft in die höher gelegenen Gebiete lässt sich allerdings noch nicht belegen. Um an Kupfer und Zinn, die Metalle, aus denen Bronze gewonnen wird, zu kommen, musste ein weitläufiges Handelsnetzwerk aufrechterhalten werden, dazu kam es zu einer Art Normung oder Absprache von Ringen, die in Umlauf gebracht wurden, und eine Art Münzfunktion übernahmen. Die Kontrolle über den Metallhandel trug wohl zur Herausbildung von strukturierten Gesellschaften bei, was sich im Obsidian- und Steinbeilhandel womöglich schon angekündigt hatte. Der Handel mit den Rohstoffen förderte weiträumige Kontakte, es entstand geradezu ein europäisches sozio-ökonomischen Netzwerk, in dem nicht nur Güter, sondern auch Menschen und Ideen „ausgetauscht“ wurden.
Die im Neolithikum bzw. in der Kupferzeit ausgebildete Sitte, den Blick der Toten nach Osten, oder eher gen Sonnenaufgang zu richten - Männer auf der linken Seite liegend, mit dem Kopf im Norden, Frauen auf der rechten Seite, mit dem Kopf im Süden - bestand fort. Doch um 1350 v. Chr. herrschte die Verbrennung und die Beisetzung in Urnen vor.
Die nachfolgende Eisenzeit wird häufig als „keltisch“ bezeichnet, doch inzwischen gelten die Kelten nicht mehr als eine Art Volk, sondern eher als Sprachgruppe. Die Kelten bedienten sich eher einer übergreifenden Händlersprache, die sich nach und nach in einem riesigen Gebiet zwischen Spanien und der Türkei durchsetzte. Die kulturelle Vereinheitlichung der Schweiz mit Ausnahme Graubündens könnte mit der Keltisierung in Zusammenhang stehen. Die schriftlichen Zeugnisse zu den keltischen Helvetiern, nach denen die Schweiz auch Confoederatio Helvetica genannt wird, stammen von Fremden, nämlich von Griechen und Römern. Steigende Wasserpegel der Seen hatten die Bewohner auf Hügelsiedlungen getrieben. Die Kelten entwickelten Siedlungen mit frühurbanem Charakter, intensivierten den Handel mit dem Mittelmeerraum und waren drauf und dran eine Staatlichkeit zu entwickeln. Doch die Römer unter Caesar unterwarfen die Kelten, die sie Gallier nannten, links des Rheins zwischen 58 und 51 v. Chr.
Die Archäologien nennen die Kulturen, die mit den Kelten verbunden werden, die Hallstattkultur, benannt nach den österreichischen Ort Hallstatt, die ihr nachfolgende Kultur von La Tène nach einem Ort in der Schweiz. Adlige Clans dominierten die Stämme, daneben spielten Druiden eine bedeutende relilgiös-politische Rolle. Menschenopfer kamen darin vor. Zugleich waren die Helvetier berühmte Schmiede, ihre Kriegerkultur ist in den reich ausgestatteten Gräbern gut erkennbar.
Im Süden der Schweiz war eher der Einfluss etruskischer Zuwanderer spürbar, die Räter im Osten waren mit ihnen verwandt. Die Räter, vielleicht ein autochthones Volk, wurden jedoch durch die Römer um die Zeitenwende weitgehend ausgelöscht, die Verbliebenen romanisiert - auch wenn in Graubünden bis heute die Vorstellung besteht, die dortigen Schweizer seien Nachfahren der Räter. Die Kelten übernahmen Elemente der griechischen und etruskischen Alphabete. Rom unterwarf zunächst die Insubrer des Tessin und die Allobroger der Westschweiz, dann die Helvetier, dann auch Stämme wie die Nantuaten, Veragrer, Seduner oder Uberer. Die Integration des Schweizer Gebiet in fünf Provinzen folgte, dann die Romanisierung; sie führte zu einer eigenstänigen gallorömischen Kultur. mit intensivierten Kontakten in den Mittelmeerraum.
Lange standen nicht einmal römische Legionen auf Schweizer Gebiet, doch im 3. Jahrhundert zogen mehrfach Germanenstämme südwärts, die den Bau von Kastellen und die Befestigung der Städte erforderlich machten. Schließlich musste der Limes, bald das flache Land aufgegeben werden. Die Römer sahen dabei das heutige Gebiet der Schweiz keineswegs als Einheit, wie die Verwaltungsreformen des späten 3. Jahrhunderts erwiesen. Im 5. Jahrhundert verstärkten sich die Angriffe der inzwischen christianisierten Burgunder im Westen und der Alamannen im Norden, bis das inzwischen christianiserte Römerreich auch in den Westalpen zusammenbrach. Auch die Burgunder wurden, nach der katastrophalen Niederlage gegen die Hunnen, zunächst umgesiedelt, dann von West- und Ostgoten bedrängt, schließlich wurde ihr Reich 532/34 von den Franken erobert.
Die Ostgoten, die ihr Reich in Italien erobert hatten, nahmen die Alamannen, die um 500 von den Franken besiegt worden waren, unter ihren Schutz. Doch als das Oströmische Reich Italien zurückzuerobern versuchte, überließen sie das Gebiet der Alamannen in der Raetia Prima sowie über Churrätien den Franken. Noch um 570/610 galten die Alamannen als Heiden. Die Gründung des Bistums Konstanz zu Anfang des 7. Jahrhunderts machte es zum eigentlichen „Alemannenbistum“. Die Romanen assimilierten sich den Alamannen bis in das 7. Jahrhundert; im Laufe des 8. und 9. Jahrhunderts stabilisierten sich die Sprachgrenzen. Nach einer Phase der Lockerung der fränkischen Oberherrschaft integrierten die Franken die Alamannen wieder stärker in ihr Reich. Die Frankenkönige sicherten sich dort die Übergänge nach Italien, die während des gesamten Mittelalters und bis in die Neuzeit für die Herrscher nördlich der Alpen von größter Bedeutung waren. Das Wallis und der Genfersee gingen drei Jahrzehnte nach dem Tod Karls des Großen an Westfranken, der Rest an Ostfranken. Der Herzogstitel, den Ludwig der Fromme für seinen Sohn Karl den Kahlen 829 geschaffen hatte, verschwand und tauchte erst im 10. Jahrhundert wieder auf.
Das Herzogtum Schwaben bestand erneut vom 10. bis zum 13. Jahrhundert unter der Ägide des Heiligen Römischen Reiches. Neben die antiken und fränkischen Stadtgründungen wuchs die Städtelandschaft langsam an. Die Kämpfe zwischen den Anwärtern auf den Herzogstitel prägten das Bild ebenso, wie die Kämpfe innerhalb der Königsdynastie und der lokalen Dynastien, dann der Kampf zwischen Kaiser- und Papsttum. So führte die Ehe zwischen Otto dem Großen und Adelheid, die den Anspruch auf Italien einbrachte, zum Aufstand des zuvor für die Nachfolge vorgesehenen Sohnes Ottos gegen die des gemeinsamen Kindes des Königspaares, das bald zur Welt kam. 1057 kam die Herzogswürde wieder an eine einheimische Familie. Wie überall spalteten sich die Adelsfraktionen angesichts des Investiturstreits zwischen Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. Von 1079 bis 1098 standen sich zwei Herzöge gegenüber. Bald begannen die Zähringer und die Staufer ihren Einfluss geltend zu machen, wobei letztere fast durchgängig den Herzogstitel trugen und Schwaben schließlich zu ihrem Kronland machten, die Zähringer die Ansprüche der Könige bekämpften. Sie erhielten Zürich als Reichslehen. 1218 starben die Zähringer aus.
Wenig später eskalierte der Kampf zwischen dem Stauferkaiser Friedrich II. und den Päpsten. Die kaiserliche Partei, zu der neben der älteren Linie der Habsburger die Städte Zürich, Bern, Schaffhausen und Konstanz sowie die Fürstabtei St. Gallen zählten, behielt die Oberhand. Friedrich versuchte Machtkonzentrationen zu verhindern. Nach dem Verschwinden der Staufermacht wurden seit Rudolf von Habsburg (1273-91) die staufischen Reichsrechte und -güter in Reichsvogteien organisiert. Ähnlich wie in Italien etablierten sich in der Schweiz mächtige Stadtherrschaften, während weiter nördlich die städtische Macht gebrochen wurde. Das Aussterben mächtiger Adelsgeschlechter sowie die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst sowie zwischen den mächtigsten Adelsfamilien begünstigten im 13. Jahrhundert die Verselbstständigung der Städte und Talschaften der Schweiz. 1218 wurden Zürich, Bern, Freiburg und Schaffhausen nach dem Aussterben der Zähringer zu Reichsstädten; der Kanton Uri erlangte 1231, die Gemeinde Schwyz 1240 ebenfalls die Reichsunmittelbarkeit.
Obwohl es 1218 schien, als würden die Staufer Nachfolger der Zähringer in Alemannien, setzten sich am Ende die Habsburger durch, die 1264 das Erbe der mächtigen Kyburger einstrichen und 1273 den König stellten. Doch die Habsburger verlagerten ihren Machtschwerpunkt bald nach Österreich.

Spätestens 1291 verbanden sich Uri, Schwyz und Nidwalden zur Eidgenossenschaft, der es 1315 gelang, die Habburger zu besiegen. Ab 1353 bestand die alte Eidgenossenschaft aus acht, von 1513 bis 1798 aus dreizehn vollberechtigten Stadt- und Länderorten sowie zahlreichen Gebieten minderen Rechts. In den Städten verdrängten nichtadlige Familen den Adel mit Hilfe der Landsgemeinde und der Zünfte. Während alle deutschen Städtebünde 1389 aufgelöst wurden, expandierte der Schweizer Bund weiter, bald wurde die Bündnisfreiheit aufgehoben und zahlreiche Schweizer Söldner kämpften auf den Kriegsschauplätzen Europas. Mit der Herrschaft über Mailand wurde jedoch der Höhepunkt überschritten. Infolge der Reformation, die mit Zwingli und Calvin verbunden ist, bekämpften sich protestantische und katholische Städte. Diese Kämpfe eskalierten im Dreißigjährigen Krieg, als sich die Großmächte auch auf dem Gebiet der Schweiz, vor allem in Graubünden bekämpften. Am Ende des Krieges schied die Eidgenossenschaft aus dem Heiligen Römischen Reich aus, nach innen dominierten von 1656-1712 die katholischen Orte unter Führung Luzerns. Doch der politische und wirtschaftliche Aufstieg der protestantischen Städte Zürich, Basel oder Genf und der Zustrom von Hugenotten sorgten für ein Übergewicht dieser Regionen, die zudem von der Industrialisierung profitierten. Die mehrsprachige Schweiz entstand trotz zahlreicher französisch- und italienischsprachiger Untertanengebiete und trotz entsprechender Zugewandter jedoch erst 1798. Aufklärung und eine veränderte Staatsauffassung, vor allem aber der Einfluss der Französischen Revolution beendeten die mittelalterlich anmutenden Gesellschaftsformen in der Schweiz. 1798 besetzte Napoleon das Land, das 1799 bis 1804 zu Frankreich gehörte. Als Integrationsmoment diente besonders nach 1815, dem Ende der napoleonischen Ära, ein übergreifendes Nationalgefühl, doch den Zusammenhalt als Staat erzwangen die Sieger. 1815 wurden am Wiener Kongress die weitgehend bis heute bestehenden Binnen- und Außengrenzen der Eidgenossenschaft anerkannt. 1859 wurde das Reislaufen, das Schweizer Söldnertum, dessen letztes Relikt die Schweizer Garde der Päpste ist, verboten.
1869 wurde die Volksinitiative eingeführt, eine Einrichtung, auf die die Schweizer bis heute stolz sind. Zum Kulturkampf kam es ab 1873), 1874 wurden Kultusfreiheit und Zivilehe eingeführt. In den Jahrzehnten um 1900, einer Zeit zunehmender Industrialisierung, wuchs der Einfluss der Arbeiterbewegung, das heutige Parteienspektrum entstand, und es erfolgte die Integration der Katholiken. Die Schweiz wurde vom Agrarland zum Industriestaat. Führend war bis zum Ersten Weltkrieg die Textilindustrie in der Ostschweiz. Während des Ersten Weltkriegs war die Bevölkerung gespalten, denn viele Deutschschweizer waren dem Deutschen Reich, viele französischsprachige Schweizer Frankreich zugeneigt. Die Konfliktlinie verlief entlang des Röstigrabens. 1920 trat die Schweiz nach einer Volksabstimmung dem Völkerbund bei, der seinen Sitz in Genf hatte. Damit begann eine Phase der differenzierten Neutralität der Schweiz. Als 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen, geriet die Schweiz unter zunehmenden Druck, in der Schweiz agierte die Frontenbewegung. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland im Jahr 1938 kehrte die Schweiz zurück zur integralen Neutralität, was vom Völkerbund anerkannt wurde. Unter dem Eindruck der deutschen Expansion bekräftigten Schweizer Politiker, Gelehrte und Militärs den geistigen und militärischen Widerstands- und Selbstbehauptungswillen. Im selben Jahr wurde das Rätoromanische als vierte Landessprache anerkannt und das Schweizerische Strafgesetzbuch eingeführt. Vom eigentlichen Krieg blieb die Schweiz weitgehend verschont, geriet jedoch wegen ihrer Flüchtlingspolitik und der Abweisung von Juden in die Kritik.
Juden lebten bereits in römischer Zeit auf dem Gebiet der Schweiz. Bis um 1350 waren ihre Gemeinden bedeutend, doch zerstörten Pogrome ihre Grundlage und 1489 beschloss die Tagsatzung die Ausweisung aus der ganzen Eidgenossenschaft für das Jahr 1491. Erst beinahe ein Jahrhundert später erschienen wieder Juden, allerdings in kleinen Orten. Während der franzuösischen Herrschaft kam es zur Gleichstellung mit der übrigen Bevölkerung, der Emanzipation, doch wurden viele Bestimmungen nach dem Ende Napoleons zurückgenommen. Durch Zuwanderung zuerst aus dem Elsass, Südbaden und Vorarlberg, dann aus Deutschland und aus Osteuropa wuchs die jüdische Bevölkerung der Schweiz von 3.000 im Jahr 1850 auf 21.000 im Jahr 1920. Erst im Juli 1944 wurden Juden als politische Flüchtlinge anerkannt. Nach neueren Untersuchungen wurden ca. 24.398 Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen. 2004 bestanden 23 jüdischen Gemeinden in der Schweiz.
Der beginnende Kalte Krieg führte besonders seit 1951 zu einer starken Aufrüstung. Die seit etwa 1932 geförderte Geistige Landesverteidigung richtete sich in der Nachkriegszeit gegen die Gefahr einer Besetzung des Landes durch die Truppen des Warschauer Pakts bzw. gegen die kommunistische Unterwanderung. Zugleich erlebte die Schweiz einen steilen Wirtschaftsaufschwung und infolgedessen eine anwachsende Zuwanderung, gegen die sich jüngst Widerstand regt. Erst 1971 stimmten die einzig wahlberechtigten Schweizer Männer der Einführung des Frauenwahlrechts zu. Erst der Aufstieg der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei führte das Land in eine Krise, die 2003 zum Ende der sogenannten „Zauberformel“ führte. Schließlich kam es zu Ansätzen zur Auflösung der über lange Zeit gepflegten Isolation. 2014 lag der Ausländeranteil bei 23,5 %, die Hälfte davon war berufstätig, nur 2,1 % waren Flüchtlinge.
Inhalt
- 1 Paläolithikum
- 2 Mesolithikum
- 3 Neolithikum (ab 6. Jahrtausend v. Chr.)
- 4 Bronzezeit (2200-800 v. Chr.)
- 5 Kelten, Eisenzeit (800-30 v. Chr.)
- 6 Geschichte der urgeschichtlichen Archäologie in der Schweiz
- 7 Teil des Römerreichs
- 8 Burgunder und Alamannen
- 9 Teil des Frankenreichs
- 10 Herzogtum Schwaben
- 11 Verwicklung in Reichskämpfe und den Kampf zwischen Kaiser und Papst
- 12 Eidgenossenschaft
- 13 Konfessionalisierung, Reformation und Gegenreformation (ab 1515); Inquisition und Hexenverfolgung
- 14 Jüdische Gemeinden
- 15 Dreißigjähriger Krieg und Graubünden, Kämpfe zwischen Frankreich-Venedig und Spanien-Österreich
- 16 Exemtion aus dem Heiligen Römischen Reich (1648), Bauernkrieg (1653)
- 17 Vormachtstellung der katholischen Innerschweiz, französische Dominanz, Parität (1656-1712)
- 18 Glaubensflüchtlinge, Hugenotten (ab 1685), Ausweisung (1699)
- 19 Ancien Régime, Zurichtung auf den Markt, Zünfte (1712–1798)
- 20 Aufklärung
- 21 Republiken, Franzosenzeit: Helvetik und Médiation 1798–1814
- 22 Die Schweiz als Staatenbund, Sonderbundskrieg (1815–1847)
- 23 Emanzipation der Juden
- 24 Der Bundesstaat
- 24.1 Gründung
- 24.2 Außenpolitische Konflikte mit Preußen und Frankreich, Verbot des Söldnertums
- 24.3 Einführung der Volksinitiative (1869), Kulturkampf (ab 1873) und Kultusfreiheit, Zivilehe (bis 1874)
- 24.4 Arbeiterbewegung, Entstehung des heutigen Parteienspektrums, Integration der Katholiken
- 24.5 Eisenbahnbau, Industrialisierung, Staatsbetriebe, Zuwanderung
- 24.6 Rotes Kreuz (1863)
- 25 Die beiden Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, Kampf um Gesellschaftssysteme, Rassismus (1914-1945)
- 25.1 Erster Weltkrieg: drohende Spaltung, „bewaffnete Neutralität“, ideologische Kämpfe, Kriegsproduktion vs. humanitäre Dienste
- 25.2 Zwischenkriegszeit: Vorarlberg sucht Anschluss, Sozialisten und Bürgerblock
- 25.3 Weltwirtschaftskrise (ab 1930/31), Politik gegen Minderheiten, Bund gegen Faschismus (1936)
- 25.4 Flüchtlingspolitik, Geistige Landesverteidigung, Anerkennung des Rätoromanischen
- 25.5 Zweiter Weltkrieg: Staatsnotstand, Widerstandspläne, Flüchtlinge, NS-Propaganda
- 25.6 Ende der Parteienkämpfe, Parteienverbote und Zensur, erste direkte Steuer, „Anbauschlacht“
- 25.7 Wirtschaftsabkommen mit Deutschland
- 25.8 Die jüdischen Gemeinden seit 1933
- 26 Nachkriegszeit und Kalter Krieg: Wirtschaftsaufschwung, Konkordanz, Aufrüstung und Ende der Geistigen Landesverteidigung sowie des Vollmachtenregimes, Frauenwahlrecht (bis 1991)
- 27 Partielle Aufhebung der Isolation, Wirtschaftskrise und Zuwanderung, Polarisierung in der Zuwanderungsfrage
- 28 Verwaltung des Kulturerbes
- 29 Fachzeitschriften
- 30 Quelleneditionen
- 31 Literatur
- 31.1 Überblickswerke
- 31.2 Monumente
- 31.3 Atlanten und Kartenwerke
- 31.4 Urgeschichte
- 31.5 Metallzeitalter, Kelten
- 31.6 Antike, Frühmittelalter
- 31.7 Hoch- und Spätmittelalter
- 31.8 Neuzeit
- 31.9 Langes 19. Jahrhundert (bis 1918)
- 31.10 Nachkriegszeit und umgebender Faschismus
- 31.11 Jüngste Geschichte
- 31.12 Wissenschaftsgeschichte
- 31.13 Bibliographien
- 32 Externe Links
- 33 Anmerkungen
Paläolithikum
Übergreifende Darstellung
Der Beginn des Altpaläolithikums, des frühesten Abschnitts der Altsteinzeit, stellt die früheste Phase der menschlichen Entwicklung dar. Sie wird mit dem frühesten Nachweis von geschlagenen Steinwerkzeugen als ersten Zeugnissen menschlicher Kultur definiert. In Afrika, wo man vom Early Stone Age spricht, setzte diese Entwicklung vor etwa 2,5 Millionen Jahren ein, in Westasien vor 1,8 Millionen, im Nahen Osten vor etwa 1,6 Millionen und in Südeuropa vor mindestens 1,2 Millionen Jahren.
Der Begriff Altpaläolithikum (als ältester Epoche der Altsteinzeit) bedeutet eigentlich „Altaltsteinzeit“. Er umfasst einen derart langen Zeitraum, überaus verschiedene Kulturen und darüber hinaus verschiedene menschliche Spezies, dass eine Grobeinteilung in ein archaisches und ein klassisches Altpaläolithikum eine Orientierung zu wesentlichen Umbrüchen zu geben versucht. Gleichzeitig mindert diese grobe Einteilung die allzu simple Vorstellung von einer weitgehenden Einförmigkeit und fehlenden Entwicklungsdynamik der Lebensweisen. Das Altpaläolithikum, für das Steinbearbeitungstechniken des sogenannten Mode 1 typisch sind, bei dem mit wenigen, in der Regel einseitigen Abschlägen, eine scharfe Kante erzielt wurde, um Geröllgeräte herzustellen, reicht bis zum ersten Erscheinen des Neandertalers (um 350.000 vor heute). Das davor liegende archaische Altpaläolithikum reicht bis um 760.000.
Die weiteren drei Phasen des Paläolithikums folgen dieser auch als Ur- oder Frühpaläolithikum bezeichneten ersten Phase und heißen Alt-, Mittel- und Jungpaläolithikum. Vereinfacht gesagt tauchten in der ersten Phase (vielleicht sogar verschiedene) Vorfahren des Menschen auf, die den großen Elefanten- und Bisonherden folgten. In der zweiten Phase haben wir es mit dem gemeinsamen Vorfahren der meisten Menschenarten zu tun, in der dritten mit dem Neandertaler und in der vierten mit unseren unmittelbaren Vorfahren, den anatomisch modernen Menschen. Aus der frühesten Phase wurden in einigen Gegenden menschliche Überreste entdeckt: Es handelt sich um archaische Formen des Homo erectus, die in Georgien, aber auch im Süden von Frankreich und im Norden von Spanien ausgegraben wurden. Die Altsteinzeit überspannt also den riesigen Zeitraum von vor über 2,5 Millionen Jahren bis zum Ende der letzten Eis- oder Kaltzeit um 10.000 v. Chr. Und selbst in Europa, wo der Mensch sehr viel später als in Afrika auftauchte, umfasst sie doch noch etwa die Hälfte dieser enormen Zeitspanne.
Die Hinterlassenschaften, fast immer steinerne Geräte, erlauben es, Räume einigermaßen einheitlicher archäologischer Kulturen abzugrenzen. Die frühesten Kulturen zeichnen sich durch grob retuschierte Abschläge oder durch ein- oder zweiseitig behauene Geröllgeräte aus. Die als Geröllkultur bezeichnete Epoche entspricht dem Alt-Pleistozän, einem Zeitabschnitt in der Erdgeschichte; ihr Ende wird meist bei einer großen paläomagnetischen Veränderung vor 780.000 Jahren angesetzt. Danach gilt der Süden Europas als durchgängig von Menschen bewohnte Region - in der Schweiz gibt es allerdings bisher keine Spuren aus dieser Epoche.
Im Altpaläolithikum (vor ca. 800.000-300.000 Jahren) wurden traditionelle Geräte weiterhin verwendet, während die ersten Faustkeilkulturen nun fassbar sind - vielleicht auch in der Schweiz. Diese Zeit, die als Acheuléen bezeichnet wird, entspricht dem mittleren Pleistozän sowie der Entwicklung der Prä-Neandertaler, die häufig als Homo heidelbergensis zusammengefasst werden. Trotz einiger Hinweise ist der Gebrauch von Feuer nicht gesichert.1


Im Mittelpaläolithikum entwickelte sich vor etwa 300.000 Jahren eine neue, nunmehr geplante Steinbearbeitung, die Levalloistechnik - der Gebrauch von Feuer war inzwischen längst selbstverständlich. Die bearbeiteten Steine ergaben Abschläge, die nicht mehr bearbeitet oder nur minimal retuschiert werden mussten, um ihren Zweck zu erfüllen. Zudem wurden die Werkzeuge kleiner und sie konnten schneller hergestellt werden. Dabei unterscheidet man ein frühes Mittelpaläolithikum des Prä-Neandertalers und ein spätes Mittelpaläolithikum des „klassischen“ Neandertalers. Letzterer erschien zu Anfang der vorletzten großen Zwischeneiszeit vor 130.000 Jahren.2
Die Neandertaler waren Großwildjäger, deren Beute aus Mammuts oder sonstigen Großsäugern bestand, und die bereits einfachen Schmuck herstellten. Dabei ist nur das späte Mittelpaläolithikum, das eine Kulturgruppe unter der Bezeichnung Moustérien umfasst, in der Schweiz reichhaltiger belegt.
Das Jungpaläolithikum, die Epoche des modernen Menschen, des Homo sapiens, begann in Europa mit dem Erscheinen des Cro-Magnon-Menschen. Das Jungpaläolithikum wird häufig als „Rentierzeit“ bezeichnet, ein Hinweis auf einen drastischen Wechsel im Jagdspektrum, zu dem nun auch kleinere Tiere, wie Kaninchen gehörten, aber auch Fische. Sein Ende wird mit der Abwanderung des Rens nach Norden angesetzt, als es um 12.500-12.000 v. Chr. wärmer wurde, die Gletscher abschmolzen und sich der Lebensraum des Rens nordwärts verlagerte. Damit dehnte sich auch das Gebiet erheblich aus, das von Menschen bewohnt werden konnte. Auch fanden sich zunehmend Spuren, die auf die Nutzung höherer Gebirgslagen hinweisen, was für ein alpines Land wie die Schweiz von größter Bedeutung ist.
Dieser Phase folgte das Spätpaläolithikum. Die Erosionen des letzten großen Gletschervorstoßes, dessen maximale Ausdehnung um 22.000-18.000 v. Chr. datiert wird, hat beinahe alle Spuren menschlicher Anwesenheit auf dem Gebiet der Schweiz beseitigt. Die letzte Kultur der Rentierjäger, das Magdalénien (18.000-12.000 v. Chr.), ist hingegen in der Schweiz gut belegt. Südlich der Alpen ist das Magdalénien allerdings unbekannt, dort entstanden Kulturen des Epigravettien.
Die Menschen entwickelten steinerne Klingen mit einer komplexen Abschlag- und Drucktechnologie, aber nun sind auch Werkzeuge aus Knochen, Elfenbein oder Geweih fassbar. Auch das Auftreten der „Kunst“ in Form von Bildern oder Musik - belegt durch Flöten - sowie sehr viel häufigere Herstellung von Schmuck wurden für diese Epoche kennzeichnend.
Altpaläolithikum
Folgt man dem 2014 fertiggestellten Historischen Lexikon der Schweiz,3 so lebten schon vor 500.000 Jahren Menschen auf dem Gebiet des heutigen Staates. Die Datierung offenbar sehr alter Funde im Elsass, wie in Achenheim oder Walheim4, in der Nordwestschweiz - Alle (Pré-Monsieur)5 - und in der Gegend von Burgdorf im Kanton Bern ist jedoch überaus unsicher. Vor ähnlichen Problemen der Datierung steht man bei anderen Funden.
Der 1974 am Südhang einer Hochterrasse des Rheins entdeckte Faustkeil von Pratteln6 - er gilt als ältestes Werkzeug der Schweiz - ist mit den Faustkeilen des französischen Alt-Acheuléen vergleichbar und dürfte dementsprechend zwischen 400.000 und 120.000 Jahre alt sein - ein sehr weiter Zeitraum. Der Pratteln-Faustkeil wurde aus lokalem, braungelbem Silex angefertigt, ist 18,1 cm lang und wiegt 1126 g.7
Mittelpaläolithikum

Die ältesten menschlichen Spuren auf Schweizer Gebiet, die sich genauer datieren lassen, reichen 120.000 bis 75.000 Jahre zurück. Sie gehen auf den Neandertaler zurück, der sicherlich schon früher dort gelebt hatte, dessen Spuren jedoch durch die Gletschermassen der Kaltzeiten vernichtet wurden. Mit der vor 115.000 Jahren einsetzenden und erst vor etwa 12.000 Jahren endenden Würm-Kaltzeit wurden die Lebensbedingungen wieder sehr viel ungünstiger, bis schließlich der Raum Genf unter einem Eispanzer von einem Kilometer Höhe lag. Ähnliches gilt für die gesamte Schweiz, wie etwa im Gebiet des Rhein- oder des Reussgletschers in der Nordschweiz. Letzterer hinterließ den Vierwaldstättersee.
Ab dem späteren Mittelpaläolithikum sind Fundstellen über die ganze Schweiz verteilt, wobei einige Faustkeile des Micoquien-Typs im Fricktal (Möhlin, Zeiningen, Magden) kaum zu datieren sind. Das Micoquien ist durch das Auftreten asymmetrischer Faustkeile charakterisiert, die wegen ihres stumpfen Rückens als „Keilmesser“ bezeichnet werden. Ihre Zahl ist jedoch nach wie vor gering. Dabei wurden überwiegend Abschläge zur Herstellung von Werkzeugen hergestellt, die dem Kulturkomplex des Moustérien angehören. Die weiteste Verbreitung der Moustérien-Gruppen liegt kurz vor deren Ende vor ca. 50.000-35.000 Jahren; hierzu zählen die meisten Funde in der Schweiz, wenn auch einige Freilandstationen an ältere Gruppen des Rhonetals erinnern. Etwas sicherer ist die Datierung beim Faustkeil von Schlieren, der 1954 gefunden und auf 60 bis 50.000 Jahre geschätzt wurde.8
Neben den seltenen Freilandstationen, die sich vor allem im Nordwesten, im Jurabogen fanden, gibt es dort Lagerplätze in Höhlen und unter Felsüberhängen oder Abris - meist zwischen 350 und 700 m hoch gelegen -, dazu Stationen in den alpinen Regionen. Die Freilandstationen - meist kurzzeitig genutzte Lagerstellen - liegen in der Region Basel auf den Rändern der Mittel- und Oberterrassen von Rhein und Birs, meist in 300 bis 350 m Höhe. Bei der Wahl dieser Plätze spielten bestimmte, besonders begehrte Steine eine bedeutende Rolle. Bei Löwenburg auf dem Gebiet der Gemeinde Pleigne fanden die Neandertaler beispielsweise einen Silex von sehr guter Qualität; ihre Spuren reichen dort 70 bis 60.000 Jahre zurück. Der Lagerplatz lag auf 570 m Höhe auf einem Hügelsporn, der das Lützeltal überragte, das Tal eines Nebenflusses der Birs. Ähnliche Standortvorteile nutzte man in der Gegend von Pruntrut: Bei Alle-Noir Bois und Pré Monsieur Lagerten Neandertaler ebenfalls erhöht über einem Fluss. Schicht 2 von Pré Monsieur stellte eine Werkstatt dar, in der sich 50.000 Bruchstücke fanden, dazu die in der üblichen Levallois-Technik gefertigten Werkzeuge.
Die meist mehrfach genutzten Höhlen, wie die Grotte des Plaints (Gemeinde Couvet, Kanton Neuenburg), liegen oberhalb der üblichen Grenze von 700 m. Die Fundstellen sind weniger zahlreich als in der Franche-Comté, in der bei La Baume de Gigny der Referenzfundort des jurassischen Moustérien liegt. Diese Höhlen liegen ausschließlich auf dem Gebiet der Birs sowie der Ausläufer des Jura südlich von Neuenburg. Dort befindet sich die wichtigste Moustérien-Fundstelle der Schweiz, die Höhle von Cotencher, in der 1964 ein menschlicher Oberkiefer entdeckt wurde. Zu jener Zeit lagen Kältesteppe und eine bewaldete Rückzugszone nebeneinander.
In der Schweiz fand man bisher nur an zwei Stellen Überreste von Neandertalern, nämlich das besagte Oberkieferstück und einen einzelnen Zahn. Dabei unterschied man zwei Neandertalertypen, nämlich einen mediterranen, der auf ein Alter von 40.000 Jahren datiert wurde (Cotencher), und einen robusteren, klassischen Typ, womöglich aus noch späterer Zeit, dessen Spuren man in einer der drei Höhlen von Saint-Brais im Kanton Jura fand: einen oberen Schneidezahn eines Neandertalers in Höhle 2, der 1955 zu Tage kam. Wahrscheinlich lebten die letzten Neandertaler gleichzeitig mit den ersten anatomisch modernen Menschen, jedoch liegen ihre Spuren auf dem Gebiet der Schweiz zeitlich weit auseinander, denn letzterer tauchte hier erst recht spät auf.
Jüngste Funde in Ajoie (Schweizer Jura), meist im Tal der Allaine, gestatteten es erstmals trotz der mageren Fundsituation (65 Artefakte) ein erstes Schema für die Installation von Siedlergruppen in drei Phasen vorzuschlagen. Bei den Werkzeugen überwiegen Schaber, darunter rechtwinklige und solche mit verdünntem Rücken, hinzu kommen Bogenspitzen und Kratzer auf Querschlag (grattoirs sur coup de tranchet).9
An hochgelegenen Orten fanden sich in den Alpen ebenfalls Artefakte. Vier regionale Gruppen lassen sich bei diesen Stationen unterscheiden: die Säntisregion (Wildkirchli in 1477 m Höhe, dann Wildmannlisloch (1628 m) und Drachenloch (2445 m), das Berner Oberland (Schnurenloch in 1230 m Höhe, dann die Chilchlihöhle (1810 m) und Ranggiloch (1845 m), schließlich Hochsavoyen und die Gegend von Onnion (Höhlen in rund 1200 m Höhe) und die Region von Orta im nördlichsten Piemont (Monfenera10 (670 m), Buco del Piombo11 (695 m). Diesen Fundstellen ist die Dürftigkeit der Gerätschaften gemeinsam. Die Menschen verwendeten gewöhnlich das Felsgestein der näheren Umgebung. So sind die im Wildkirchli gehauenen Abschläge aus Quarzit von recht guter Qualität. Unter den erkennbaren Steingeräten befinden sich Levallois-Abschläge, Schaber, sowie gekerbte und gezähnte Stücke.
Jungpaläolithikum

Um 35.000 v. Chr. erschienen wieder Jäger und Sammler, doch diese waren nicht mehr Neandertaler sondern unsere unmittelbaren Vorfahren, wobei sich ihre Anwesenheit in der heutigen Schweiz weitgehend auf das Magdalénien (18.000-12.000 Jahre v. Chr.) beschränkt. Nach der bisherigen Fundsitutation zu urteilen, dürften sich Neandertaler und Cro-Magnon-Menschen nie begegnet sein. Das Aurignacien, die älteste archäologische Kultur des europäischen Jungpaläolithikums, und das Gravettien des mittleren Jungpaläolithikums sind nur nördlich von Schaffhausen im schwäbischen Jura belegt.
Unsere unmittelbaren Vorfahren lebten zunächst unter überaus rauen Bedingungen. Im Bereich des Genfersees teilte sich der Rhonegletscher, der sich mit den Gletschern aus den Berner und Walliser Alpen vereinigte, in zwei Arme, von denen der eine weiter rhoneabwärts bis in die Gegend östlich von Lyon reichte. Der andere Arm dehnte sich nach Nordosten aus, wobei er das ganze westliche Mittelland bedeckte und sich um Bern mit dem Aaregletscher vereinigte.
Die Gletscherschmelze setzte vor 18.000 Jahren ein. Um 11.000 v. Chr. reichte der Gletscher noch bis in den Raum Brig. Doch nach und nach schmolzen auch die größten Gletscher ab, die Vegetation der Tundra erklomm mit dem milderen, wenn auch immer noch sehr rauen Klima auch größere Höhen. Die Rückkehr des Waldes war ein komplexer Prozess, der sich über sehr viel längere Zeit hinzog. Um 3000 v. Chr. bestanden dichte Wälder weite Gebiete der Schweiz.
Die meisten Fundstellen des Magdalénien liegen zwischen Genf und Schaffhausen. Einige Stationen, wie Moosseedorf-Moosbühl, zeigen ein Vordringen ins Mittelland an. Die Besiedlung der nach dem Abschmelzen der Gletscher freigewordenen Gebiete erfolgte von den wenigen bewohnbaren Regionen aus. Dabei kam die Migration aus den Zentren des Magdalénien in Osfrankreich. Doch der riesige Rhonegletscher im Genferseebecken, der heute kaum mehr 16 km² bedeckt und nur noch oberhalb von 2200 m besteht, war bis zu 2 km mächtig und ließ zunächst nur eine Besiedlung im eisfreien Nordwesten der Schweiz zu, dann des Gebiets um Rhein, Bodensee und Jurarand bis Neuenburg.

Magdalénien-Gruppen wurden erstmals in der Kastelhöhe im Birstal (Gemeine Himmelried) belegt. Die Fauna weist auf eine steppenartige Landschaft hin. Die Fundstellen der Zeit um 14.000 v. Chr. weisen Spezialisierungen auf Kleinwild wie Schneerebhuhn, Schneehase, Polarfuchs, auf alpine Arten wie den Steinbock oder auf große Herdentiere wie Rentier oder Pferd auf.
Am Ende des mittleren Magdalénien entstanden Dreieckspitzen und sogenannte Baguettes demi-rondes oder halbrunde Stäbchen.13 Darunter versteht man 8,5 bis 38 cm lange, etwa 0,5 bis 2 cm dicke, brotlaibförmige (daher der Name), aus Rentiergeweih, seltener aus Knochen hergestellte Halterungen für Projektilspitzen. Sie wurden meistens verziert, die Innenseiten angeraut, um der Klinge, die eingeklebt wurde, mehr Halt zu geben.
Die Höhle Kesslerloch bei Thayngen im Kanton Schaffhausen weist eine Schichtung auf, die sich über das gesamte Spätmagdalénien erstreckt. Die kurzen Geschossspitzen mit langer Basisabschrägung erinnern dabei an das französische Magdalénien III, die Harpunen mit einer Widerhakenreihe eher an das Magdalénien V. Die zugehörige Fauna, die das Mammut, das Wollnashorn und den Moschusochsen umfasst, verschwand in der Schweiz vor dem Bölling-Interstadial bereits vor 13.000 v. Chr., vor einem verhältnismäßig warmen Zeitabschnitt also, der um 11.720 bis 11.590 v. Chr. angesetzt wird.

Ab etwa 13.500 v. Chr. breitete sich rasch das Spätmagdalénien aus, das durch Rückenmesser gekennzeichnet ist. Bei diesen auch als Federmesser bezeichneten Fundstücken handelt es sich um kleine, sehr scharfe und meist in einem Heft befestigte Klingen. Rückenmesser bestehen aus einer Klinge, deren eine Längsseite durch eine Kantenretusche konvex gewölbt wurde. Mit den geraden Längskanten der Rückseiten wurden zwei Federmesser aneinander gelegt und in einen hölzernen Pfeilschaft mittels Birkenpech eingeklebt.
In dieser Zeit erfolgte die erste großflächige Ausbreitung von Gehölzen, vor allem von Kiefer- und Birkenwäldern, nach der letzten Kaltzeit. Um 12.500 v. Chr. breitete sich die bis dahin seltene Waldkiefer schnell aus, hingegen verschwand das Rentier, das nicht im Wald lebt. Stattdessen breiteten sich als typische Waldbewohner der Hirsch, das Reh und das Wildschwein aus. Der Wald kehrte zurück und wurde dichter.
Das späte Magdalénien lässt sich in zwei Gruppen unterteilen. Die erste, für die die Fundstellen von Hauterive-Champréveyres und Neuenburg-Monruz als Referenzorte gelten, enthält mehr als 50 % einfache Rückenmesser, während die zweite, vertreten durch die Freilandstation von Moosseedorf-Moosbühl, hohe Anteile an endretuschierten Rückenmessern, Rechtecken und Bohrern mit ausgezogener Spitze aufweist.
Die nächste vergleichsweise kurz anhaltende Klimaerwärmung nach einem erneuten Kälteeinbruch, der als Älteste Dryaszeit bezeichnet wird, führte zu einer weiteren sprunghaften Veränderung in der Vegetation. Aus der Kältesteppe wurde erneut eine Landschaft mit Baumbewuchs. Im Bölling-Interstadial (etwa 11.720 bis 11.590 v. Chr.) breiteten sich Wacholder und Birken aus, Menschen erschienen nun in höheren Lagen. Die Besiedlung des Mittellandes setzte ein, Menschen lebten nun zwischen Alpen und Jura in der Region Bern. Magdalénien-Verbände aus Savoyen erreichten das Ende des Genfersees. Inzwischen zeigen neuere Untersuchungen allerdings, dass nicht erst während dieser wärmeren Phase, sondern bereits während der Ältesten Dryaszeit, also etwa um 11.850 bis 11.720 v. Chr., wieder Menschen auf dem Hochland der Schweiz überlebten - trotz extremer Bedingungen. Wahrscheinlich lebten sie sogar schon 23.000 cal. BP nur etwa 50 km nördlich des Gletscherrandes, wenn auch unter härtesten Bedingungen.15

Während dieser Periode bestanden die Kulturen des klassischen Spätmagdalénien fort, doch nun traten neue Gruppen in Erscheinung. Deren steinerne Kompositgeräte, also Geräte aus mehreren Bestandteilen, die miteinander fest verbunden wurden, weisen geknickte Rückenspitzen und Kerbspitzen vom Hamburger Typ auf. Die Stationen von Winznau in der Region Olten, der Kohlerhöhle (Brislach) und der Brügglihöhle (Nenzlingen) im Birstal sind ebenso typisch für dieses ausgehende Magdalénien wie Rentier, Pferd und Schneehase, aber auch bereits Waldtiere.
Die Kunst des Spätmagdalénien beschränkte sich, im Gegensatz zu Frankreich, von wo die grandiosen Höhlenmalereien weltberühmt sind, auf mobile Kleinkunst. Malereien oder Ritzzeichnungen an Höhlenwänden fehlen in der Schweiz. Zwei Fundstellen gehören der ältesten Epoche des Spätmagdalénien an: das ca. 200 m² große Kesslerloch und die Freudenthal-Höhle (Schaffhausen). Die übrigen Fundstellen stammen aus dem mittleren oder dem ausgehenden Spätmagdalénien. Das Kesslerloch barg etwa 40 verzierte Artefakte sowie Knochen mit nichtfigürlichen Zeichenspuren. Die meisten der figürlichen Darstellungen befinden sich auf neun Speerschleudern, sieben „Baguettes“ und vier „Lochstäben“, deren Funktion seit zwei Jahrhunderten diskutiert wird. Die übrigen Artefakte verteilen sich auf Fragmente von gravierten Rentiergeweihen oder Knochen, länglich-spindelförmige Skulpturen, zwei gravierte Plättchen aus Braunkohle und eine Plastik - vielleicht ein Insekt - aus Gagat. Neben dem Moschusochsenkopf - wohl ein Element einer Speerschleuder - ist der 1874 beschriebene Lochstab mit dem Bildnis eines Rentiers das bekannteste Fundstück des Kesslerlochs.16
In den beiden benachbarten Fundstellen im Petersfels und im Schweizersbild wurden die wichtigsten Kunstwerke aus der Zeit des jüngeren Spätmagdalénien geborgen. Weitere stammen aus der Rislisberghöhle (Oensingen), aus Neuenburg-Monruz (wo erbeutete Pferde ab 13500 v. Chr. verarbeitet wurden) und aus Veyrier im Kanton Genf. Die Kunst unterscheidet sich von der vorhergehenden Phase durch eine größere Stilisierung. Die Wiederholungen von Sujets auf demselben Gegenstand wurden häufiger und können sich überlagern, wie auf dem Schieferplättchen vom Schweizersbild mit seinen drei eingeritzten Pferden und den fünf Hirschen. Die Kunst des jüngeren Spätmagdalénien ist aber vor allem durch die Frauenfigürchen aus Gagat gekennzeichnet. Die extrem schematisierten Kleinstatuetten sind meist an jener Stelle durchbohrt, an der sich der Kopf befinden sollte, der nie dargestellt ist. Die Frauendarstellungen des Spätmagdalénien erscheinen zwischen dem Süden Frankreichs und der Elbe und werden aus Gründen der Tradition als „Venus“ bezeichnet - ein inzwischen umstrittener Begriff.
Mesolithikum

Das Mesolithikum, die Zeit zwischen der letzten Kaltzeit und dem Beginn der produzierenden Lebensweise, dem Neolithikum, galt lange als eine Periode kulturellen Niedergangs der beeindruckenden Kulturen der Jäger und Sammler. Daher stand diese Periode, die in Mitteleuropa von etwa 9600 bis in das 6. Jahrtausend v. Chr. reichte, in Westeuropa im Schatten des Magdalénien der Großwildjäger einerseits und des beginnenden Bodenbaus und der Viehhaltung andererseits, einer Epoche, die als „neolithische Revolution“ bekannt wurde.
Trotz früher Funde änderte sich dies erst ab den 1950er Jahren. Wichtige Grabungen fanden durch René Wyss in Liesbergmühle (Liesberg)18, Robenhausen (Wetzikon, Zürich) und in der Region Wauwil19 im Kanton Luzern statt,20, dann in Birsmatten (Nenzlingen)21, in Ogens und Baulmes.22, Collombey-Muraz23 und am Col du Mollendruz (Mont-la-Ville)24. Die Rolle des Mesolithikums für den Übergang von den Jäger-, Sammler- und Fischergesellschaften zu einer vom Boden und von Haustieren lebenden Gesellschaft wird inzwischen sehr viel höher eingeschätzt.25
Die überaus mobilen Jäger und Sammler hinterließen als Spuren große Mengen von geometrischen Mikrolithen, die z. B. für Speere oder Harpunen gebraucht wurden. Dabei bildeten das Mittelland und der Sâone-Rhone-Korridor Berührungs- und Überlappungszonen kultureller Strömungen. Den Achsen von Rhein und Rhone folgend trafen sich Beuronien (9600-7000 v. Chr., es findet sich von Paris über Hessen im Norden bis an die Karpathen im Osten und die Alpen im Süden26) und Sauveterrien, die sich beide mit lokalen Traditionen verbanden. Anscheinend dominierte das norditalienische Sauveterrien (9500-7000 v. Chr.) die Alpensüdseite ebenso wie die Westschweiz - kennzeichnend sind sehr kleine, schmalbasige Pfeilbewehrungen, vor allem die stark zugespitzten Sauveterre-Spitzen. Nordjura und Zentral- und Ostschweiz standen hingegen im Frühmesolithikum (bis 8000 v. Chr.) in einer nördlichen Tradition, dessen Mikrolithen vorrangig retuschierte Spitzen aufwiesen. Wie die Belegungsschichten des Felsüberhangs am Mollendruz erweisen, traten aber auch in der Westschweiz Elemente des Beuronien auf.
Zahlreicher sind die Überreste aus dem mittleren Mesolithikum (8000-7000 v. Chr.). Die Nordschweiz war vom Beuronien geprägt. Bei den Mikrolithen überwiegen ungleichschenklige Dreiecke sowie Spitzen mit retuschierter Basis, so etwa am Fundort Les Gripons (Saint-Ursanne) oder Ritzigrund (Roggenburg). Dabei weisen Spitzen mit Basisretusche im Rhonegebiet sowie einige Sauveterrien-Spitzen im Nordjura auf wechselseitige Einflüsse mit der Süd- und Westschweiz hin. Die Mikrolithen der Westschweiz sind dabei vergleichsweise klein.
Mit dem Spätmesolithikum tauchte in weiten Teilen Europas ein neuer Typus von Mikrolithen auf, das Trapez. Auch änderte sich die Bearbeitungstechnik von Feuersteinen. Werkzeuge mit Klingen, insbesondere Klingen mit Kerben und unregelmäßigen Retuschen, sogenannte Montbaniklingen, stellten nun die Mehrheit der Artefakte. Im Nordjura und in der Zentralschweiz finden sich nun aus Hirschgeweih hergestellte Harpunen.
Im Endmesolithikum, einer Phase, in der es möglicherweise schon zu ersten Kontakten mit neolithischen Bauern- und Hirten-Gruppen kam, entstanden neue Mikrolithtypen, wie die asymmetrischen Dreieckspitzen (fléchettes) mit konkaver Basis. Kontext und Chronologie sind allerdings noch unsicher.
Für das Abri am Mollendruz, einen Felsüberhang, ließen sich mehrere Herdstellen mit unterschiedlichen Funktionen ebenso identifizieren, wie verschiedene Tätigkeitszonen, die der Mikrolithenherstellung, der Bearbeitung von Feuerstein oder von Häuten und Knochen vorbehalten waren. Dort weisen mehrere Pfostenlöcher, die eine Fläche von 7 m² umfassen, auf ein Zelt oder eine Hütte hin. Außer dem Lagerplatz Schötz 727 im Wauwilermoos im Kanton Luzern - er war auf die Hirschjagd und die Bearbeitung von Geweih und Knochen ausgerichtet und barg daher keinen Wohnbereich - ließ sich in der Schweiz bisher keine Freilandfundstelle analysieren, die gute Fossilisationsbedingungen aufweist und zugleich erst in jüngerer Zeit freigelegt wurde. Hobbyarchäologen richten in der Schweiz erhebliche Schäden an, die von ihnen durchwühlten Stätten verlieren jeden Aussagewert.
Das gesamte Gebiet nördlich der Alpen war seit dem Frühneolithikum bevölkert. Im Mittelland lässt sich eine Häufung von Freilandstationen an kleinen Seen oder auf Flussterrassen feststellen, im Jura eine entsprechende Belegung der Abris. Im alpinen Sektor bleiben die Lagerplätze jedoch auf die äußeren Ränder beschränkt. Auf der Alpennordseite ist die Begehung höherer Lagen bis auf etwa 1500 m belegt, wie Funde in den Westschweizer Voralpen zeigen, u.a. im Greyerzerland (Charmey, Jaun), im Pays d'Enhaut (Château-d’Œx, Rougemont) oder in den Berner Gemeinden Saanen und Boltigen. Vermutlich gab es eine saisonale Nutzung der Hochgebirgszonen bis auf mehr als 2000 m, wie etwa Fundorte auf der Südseite des Splügenpasses, der auf einer Höhe von 2115 m liegt, oder in Tec Nev (Mesocco) nahelegen. 2003 wurden auf dem über 2000 m hohen Simplonpass mehrere Raststätten entdeckt.
Die Gruppen wanderten im Jahreslauf entsprechend ihren materiellen und immateriellen Bedürfnissen. Sie nutzten zahlreiche Rohstoffe und reduzierten so das Risiko von Mangel und vermieden zugleich die Übernutzung einer einzelnen Ressource. Am Abri von Collombey-Muraz erweist sich, dass einerseits die Fauna aus den Gewässern der Rhoneebene genutzt, andererseits im bewaldeten Hinterland Säugetiere gejagt wurden.
Pflanzen spielten für die Jäger und Sammler nicht nur als Nahrung eine Rolle, sondern auch für medizinische und handwerkliche Zwecke. Sie lieferten Holz, Fasern, Zunder und Harze, wobei letztere als Klebstoffe fungierten. Fassbar sind deren empfindliche Überreste allerdings nur selten. Die große Menge verkohlter Haselnussschalen ist eines der wenigen Zeugnisse, doch dürfte die Rückkehr der Wälder eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten geboten haben, sich daraus zu versorgen.
Der meiste Feuerstein wurde vermutlich auf den zyklischen Wanderungen gesammelt. Die dazu notwendigen Territorien umfassten vielleicht 2.000 bis 4.000 km². Kontakte mit Nachbarn dürften sich durch vielfältige Formen des Austauschs ausgedrückt haben. So ist der Umlauf von Schmuck bereits vom Jungpaläolithikum an belegt. Im Mesolithikum belegt die Ausbreitung von Muscheln, genauer von Columbellaanhängern (Columbella rustica) von der Mittelmeerküste rhoneaufwärts Formen des Tausches über weite Distanzen. Wie und warum dieser Tausch vonstatten ging, ist unklar. Der Fund von drei perforierten fossilen Muscheln in Ritzigrund (Roggenburg), die aus dem Pariser Becken stammen, weist auf ein frühes Verbreitungsnetz weit Richtung Westen hin.
Birsmatten (Nenzlingen) ist die einzige in der Schweiz bekannte mesolithische Bestattung (7500-7000 v. Chr.), nämlich die einer etwa 40-jährigen Frau von 1,60 m Größe, die zwischen 1940 und 1946 im Zuge einer Ausgrabung geborgen wurde. Die Frau wurde in gestreckt-liegender Position abgelegt.28 Am Abri von Collombey-Muraz zeigte sich, dass die Verbrennung des dort aufgefundenen Erwachsenen unbestimmbaren Geschlechts und Alters nicht vor Ort stattgefunden hatte und die verkohlten Knochen eingesammelt und in einer Grube beigesetzt worden waren (1. Hälfte des 8. Jahrtausends). Außerhalb der Schweiz lässt sich zeigen, dass zudem neue Formen des Umgangs mit den Toten entstanden. So traten kollektive Bestattungen auf, ebenso wie sekundäre Bestattungen, bei denen die Knochen beigesetzt wurden, nachdem der Leichnam eine bestimmte Zeit an einem anderen Ort gelegen hatte. Wir dürfen komplexe Bestattungsrituale und entsprechende religiöse Vorstellungen annehmen.
Diese komplexen Kulturformen wurden gegen Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. von einer frühen agrarisch orientierten Lebensweise abgelöst. Es scheint, dass die jägerischen Gesellschaften an den allmählichen Veränderungen, die Bauern und Hirten aus dem Norden und Westen auslösten, beteiligt waren, und dass manche Eigenheiten ihrer kulturellen Identität die fundamentalen Veränderungen überdauerten.
Neolithikum (ab 6. Jahrtausend v. Chr.)
Die Bodenbearbeitung und die Viehhaltung erlaubten eine eigenständige Produktion von Lebensmitteln, die nach und nach immer stärker in Gegensatz zum bisherigen Jagen, Fischen und Sammeln geriet. Die neue Produktions- und Lebensweise hatte ihre Wurzeln im 11. Jahrtausend v. Chr. im Nahen Osten. Zwischen 7400 und 7100 v. Chr. begann die Ausdehnung der neolithischen Lebensformen Richtung Westanatolien, von dort einerseits über See nach Südgriechenland und schließlich nach Süditalien (dort ab 6100 bis 5800 v. Chr.) und Südfrankreich (dort ab 5700 v. Chr.), andererseits über Land Richtung Balkan (um 6500 bis 6400) und Mitteleuropa (Bandkeramik). Von der Mündung der Rhone verbreitete sich die weiterentwickelte Nahrungsmittelproduktion nach Norden und erreichte etwa 300 Jahre vor der Bandkeramik den Rhein und seine Nebenflüsse bis zur Lippe. Der Anteil von Haustierknochen ist in den Funden dieser Kultur, der La-Hoguette-Kultur, erheblich größer als bei den eher bäuerlichen Bandkeramikern weiter im Osten, es handelte sich also eher um eine Hirtenkultur. Diese beiden Kulturen beeinflussten den Schweizer Raum. Die Vorfahren der Bandkeramiker, einer Kultur, die in Frankreich als Rubané bekannt ist, stammten im übrigen nicht aus dem Nahen Osten, wie genetische Untersuchungen erwiesen.29 Lange Häuser mit Holzständern dominierten hier wie dort die Dörfer, die geradezu zum Signum der neuen Lebensweise wurden.
Die Erforschung des Neolithikums ist in der Schweiz eng mit derjenigen der Pfahlbauer verbunden, weil in den Ufersiedlungen besonders gute Erhaltungsbedingungen vorliegen.30 Erste Getreidekörner fand man im Wallis. Sie stammen aus dem 5. oder 4. vorchristlichen Jahrtausend, im Raum Zürich ließ sich archäobotanisch Getreideanbau vor 4500 v. Chr. nachweisen. Möglicherweise übernahmen mesolithische Gruppen einzelne neolithische Kulturelemente sogar noch erheblich früher, doch erlitt diese autochthone, aus dem Gebiet selbst entwickelte Neolithisierung immer wieder Rückschläge, vor allem im 6. Jahrtausend.
Die ältesten Pfahlbauten stammen aus der Zeit um 3700 v. Chr., älteste Dorfspuren mit voll entwickelter neolithischer Wirtschaft kennen wir bereits aus der Mitte des 5. Jahrtausends. Sie fanden sich bei Auvernier-Port am Neuenburger See. Die Töpferei hatte sich durchgesetzt, auch Viehhaltung gehörte zu den Siedlungen, die sich rund um die Alpen fanden, ebenso wie Weberei (?). Die Toten wurden in Kistengräbern beigesetzt.


Die heutige relative Chronologie beruht in erster Linie auf den Arbeiten von Delley-Portalban (1962-79), von Twann (1974-76) in den Kantonen Freiburg und Bern sowie von Zürich-Kleiner Hafner (1967-69, 1981-84) sowie auf der Dendrochronologie. Erst durch pollenanalytische Forschungen konnte eine Vorläuferphase mit Ackerbau, aber ohne Viehzucht und Keramik nachgewiesen werden. Eine jüngere präkeramische Phase mit Ackerbau und Viehzucht ist anzunehmen, aber bisher nicht nachgewiesen.
Die Zeit zwischen 4300 und 2400 v. Chr. ist im Mittelland dank der Feuchtbodensiedlungen gut belegt. Das Mittelland ist für diesen Zeitraum eines der reichsten Fundgebiete Europas. Hingegen ist für die Zeiträume vor und nach dieser Periode die Fundlage sehr schlecht, insbesondere für die Zeit zwischen 6500 und 4300 v. Chr. gibt es nur geringe Spuren. Etwas besser sieht es mit Funden zwischen 2400 und 2200 v. Chr. aus. Eine Systematisierung der Kulturenbezeichnungen für das Schweizer Neolithikum hat sich noch nicht durchgesetzt, daher bleibt die Vielzahl der Bezeichnungen verwirrend.
Präkeramisches und Frühkeramisches Neolithikum (6. Jahrtausend bis 4300 v. Chr.)

Nur durch Pollenanalysen ist der früheste Ackerbau nachweisbar. Die aufschlussreichsten Funde stammen vom Lagerplatz Schötz 7 im Wauwilermoos im Kanton Luzern. Charakterisiert werden diese durch Silextrapeze und Hirschgeweihharpunen.
Aus den jüngsten Grabungen in Arconciel-La Souche im Kanton Freiburg stammt ein Stempel aus gebranntem Ton, ein Pintadera. Der Tonstempel wurde um 6200 bis 6000 v. Chr. datiert31 und belegt Kontakte zum Balkan. Ob damit auf die Haut, auf Brot, Keramik oder Kleidung gestempelt wurde, ist unklar.
Das frühkeramische Neolithikum (5400-4300 v. Chr.) lässt sich nur in Form einiger Keramikbruchstücke fassen, die sich jedoch durch Vergleich mit ausländischen Funden einordnen lassen. Dabei unterscheiden sich die Süd-, die West- und die Ostschweiz kulturell deutlich voneinander. Weniger deutlich ist die Eigenständigkeit des Wallis, wo Süd- und Westbeziehungen erkennbar sind, wie im späteren Neolithikum. Aus der Zentralschweiz sind nur Silices bekannt. Eine Siedlung in Graubünden (Zizers) weist Elemente aus dem westlichen Mitteleuropa mit Elementen aus dem Neolitico inferiore padano-alpino auf, dem im Po-Alpenraum vertretenen Neolithikum. Die Nordschweiz war mit den La-Hoguette-Scherben aus Liestal zuerst westwärts, danach mit Funden der Bandkeramikkultur aus Bottmingen nordwärts ausgerichtet. Dabei ergibt sich, dass sich zwischen Südostfrankreich und dem Oberrheingebiet zwischen 4800 und 4400 v. Chr. kaum Beziehungen nachweisen lassen, während die Beziehungen zu den donauländischen Kulturen eng waren. Zwischen 4400 und 4000 v. Chr. erlauben die bisherigen Keramikfunde, drei Kulturräume zu unterscheiden, und zwar den donauländischen im Norden, das Chasséen-Gebiet im Süden und zwischen diesen beiden das Gebiet der Egolzwiler Kultur, der Saint-Uze-Gruppe und der Gonvillars-Fazies (Grotte de la Baume).32
Mittleres keramisches Neolithikum (4300-2400 v. Chr.), Kupferverarbeitung
Die Westschweiz mit ihrer Abfolge vom Cortaillod ancien bis tardif (Früh- bis Spät-Cortaillod) weist Beziehungen zu Ost- und Südfrankreich auf. Die Egolzwiler Kultur in der Zentralschweiz (ab etwa 4300 v. Chr.) war ausgesprochen eigenständig, während das dortige Cortaillod nach Westen ausgerichtet war. In der Ostschweiz liegt hingegen mit der Abfolge von später Rössener bis zur spätesten Pfyner Kultur eine Entwicklung vor, die von Mitteleuropa geprägt war. Die Grenzen liegen nahe der Sprachgrenze im Westen und auf der Linie Limmat-Zürichsee im Osten.
Vom Mittelland sind die Entwicklungen im Tessin, im Wallis und Graubünden zu trennen, wobei bis zur Lagozzakultur einschließlich im Tessin die Ausrichtung auf die Poebene deutlich ist. Das Wallis erscheint mit seiner kannelurverzierten Keramik, also von Tongefäßen, die durch Furchen verziert wurden, als eigenständig. Auch wenn es nach Westen und Süden Beziehungen unterhielt. Graubünden weist lange Zeit nur kleine Fundkomplexe auf, aber kurz vor 3000 v. Chr. sind erstmals vollständige Gefäße greifbar (Tamins). Neben Beziehungen zum Tessin erweist sich bereits hier die Eigenständigkeit der Region. Zwischen 3800 und 3500 v. Chr. verstärkte sich der Einfluss des östlichen Mittellands in der Zentralschweiz. Nach 3500 v. Chr. manifestierte sich mit den flachbodigen Keramikgefäßen im Port-Conty und in der Horgener Kultur der mitteleuropäische Einfluss in der Westschweiz. Sie orientierte sich in der Phase der Lüscherzer Kultur wieder ganz nach Westen und Südwesten.

Während des mittleren keramischen Neolithikums mit den eng aufgereihten kleinen Häusern, bestand kaum eine sichtbare Hierarchie. Ab 3600 v. Chr. kennt man dank der dendrochronologischen Auswertung mehrere Dörfer, bei denen ein Wachstum der Siedlung aus einem Kern von einem oder wenigen Häusern erfolgte. Diese Siedlungen wurden wohl von einem benachbarten Standort aus gegründet. Am Bielersee sind über die nachgewiesenen Dorfstandorte zwischen 3800 und 2400 v. Chr. etwa neun Dorfterritorien anzunehmen, die etwa zwei bis drei Kilometer des Ufers kontrollierten. Ausgehend von den erschlossenen neun Dorfterritorien aus dem 29. Jahrhundert am Bielersee könnte man die Größe eines Dorfterritoriums schätzen. Bei einem solchen Territorium von durchschnittlich 50 km² im 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. käme man auf 200 Territorien im Mittelland, was bei etwa 100 Personen pro Territorium schon etwa 20.000 Bewohner bedeuten würde.
Aus der Zeit vor 5000 v. Chr. sind Spuren vierschiffiger Langhäuser der Bandkeramik aus Gächlingen sowie ein zweischiffiges Haus von Bellinzona des Neolitico inferiore bekannt. In den Ufersiedlungen handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um zweischiffige Pfostenbauten. Die Häuser sind in der Schweiz spätestens ab 4300 v. Chr. eng in Reihen angeordnet, wobei sich in der Zentralschweiz vielfach das einreihige Dorf nachweisen lässt. Die Fläche der Siedlungen variierte zwischen 0,1 und 0,5 ha. Es standen 10 bis 50 Häuser in einem Dorf, was vielleicht 50 bis 250 Bewohnern entsprach.

Doppelspitzen mit Resten von Birkenteer, der als Klebstoff diente, belegen die Verwendung von Silex als Geschossspitzen ab etwa 3800 v. Chr. (Zürich-Hafner/Seefeld). Sie sind auch im Horgen und im Endneolithikum belegt. In der Zentralschweiz fehlt die asymmetrische, geschäftete Variante. Pfeilspitzen wurden fast ausschließlich aus Silex hergestellt, für dessen Abbau im Jura, wie etwa bei Löwenburg, Bergwerke entstanden. Dabei sind Silexkerne in den Ufersiedlungen so selten, dass sich der Schluss aufdrängt, dass vor allem Klingen und fertige Werkzeuge eingetauscht wurden. Silex besserer Qualität erhielt man aus bis zu 400 km entfernten Orten in den Nachbarländern, wie etwa Silexdolche vom Gardasee (um 3400 v. Chr.) oder Dolche von Grand-Pressigny bei Tours (um 2800/2600 v. Chr.). Holz, Hirschgeweih und Knochen spielten weiterhin eine bedeutende Rolle, zumal auch Gefäße aus Holz hergestellt wurden.
Ab 3800/3700 v. Chr. kam auch das Kupferbeil hinzu, zumindest in der Ost- und Zentralschweiz. Dort war die Bedeutung des Kupfers sicher viel größer als in der Westschweiz. Das Kupfer stammte meist aus dem Osten. Erst ab 3000 v. Chr. wurde auch in Südfrankreich Kupfer gewonnen, was zu mehr Kupferfunden in Form von Beil- und Dolchklingen sowie Perlen in der Westschweiz führte. Dank Belegen aus den österreichischen Alpen darf auch in Graubünden mit Kupferabbau gerechnet werden. Andere Metalle waren selten und wurden wohl eingeführt. Nur aus der Zeit um 2400-2200 v. Chr. kennen wir einen silbernen Ohrring aus Sitten und den goldenen Glockenbecher aus Eschenz (Kanton Thurgau), der wohl aus Großbritannien stammt.33

Ein Leinsamen aus dem 7. Jahrtausend v. Chr. könnte ein Hinweis auf frühe Textilien sein, Geflechte aus Eichen- und Lindenbast tauchten vielleicht noch früher auf. Schwere kegelförmige Webgewichte, die sich für die Leinenverarbeitung eignen, sind in der Schweiz ab etwa 4000 v. Chr. belegt. Die runden leichteren Webgewichte, die für die Verarbeitung von Wolle geeignet waren, sind ab etwa 3400 v. Chr. zu fassen - Wolle hält sich in den feuchten Häusern sehr schlecht, sie könnte also schon früher verarbeitet worden sein. Spinnwirtel wurden gelegentlich etwa ab 4000 v. Chr. gefunden, doch erst erst um 3400 (Arbon-Bleiche 3) treten sie häufiger auf. Ab etwa 3400 v. Chr. wuchs die Bedeutung von Schafwolle.
Menhirgruppen,34 meist aus dem 4. oder 3. Jahrtausend, sind auf die Westschweiz begrenzt. Unter den Felszeichnungen sind diejenigen aus Saint-Léonard hervorzuheben. Religiöse Vorstellungen stehen wohl auch hinter den Keramikgefäßen mit Frauenbrüsten aus der Cortaillod-Kultur und hinter Brüsten als Verzierung der Hauswände von Thayngen-Weier aus der Pfyner Kultur. Hinweise auf Opfer sind sehr selten. In Twann deutet ein fast vollständiges Skelett eines Mutterschweins unter einer Herdstelle aus dem 31. Jahrhundert v. Chr. auf ein Bauopfer hin. Daneben könnten Steinbeile und Lochäxte aus Flüssen geopfert worden sein.

Häufig sind nur die Steinkistengräber des 5. und 4. Jahrtausends in der Westschweiz, dem Wallis und in der Zentralschweiz. Die Toten wurden in Hockerstellung beigesetzt. Im Wallis wurde um 4500 v. Chr. nur eine Person pro Grab bestattet, später auch mehrere. Im Genferseegebiet waren es bis zu sieben Tote, in Lenzburg bis zu siebzehn.
Im 3. Jahrtausend kamen Dolmen von etwa 2 mal 3 m Größe auf, in denen bis zu 90 Menschen (Sitten-Petit Chasseur 3) bestattet wurden. Zu nennen sind der Dolmen von Aesch (2400 v. Chr.), der von Laufen, der Pierre-Percée, der Dolmen von Praz Berthoud, die einzige Megalithanlage im Kanton Waadt. Die meisten stammen aus der Zeit zwischen 4100 und 3200 v. Chr.; viele von ihnen weisen ein Seelenloch auf.
In der Ostschweiz sind nur sehr wenige Bestattungen nachgewiesen, Kollektivgräber fehlen ganz. Die neolithischen Gräber der Ostschweiz bestehen vor allem aus Bestattungen in Höhlen und unter Abris (Schweizersbild). In die 1. Hälfte des 4. Jahrtausends fallen Gräber aus dem Kanton Schaffhausen, in denen die Toten in gestreckter Rückenlage bestattet wurden. Von dieser vielleicht für die Ostschweiz typischen Bestattungsart vor der Schnurkeramik weichen nur die beiden Steinkisten von Erlenbach (4. Jahrtausend) wohl mit Hockerbestattung ab. Mit der Schnurkeramik sind in Schöfflisdorf und Sarmenstorf Brandgräber unter Grabhügeln nachgewiesen. Eine Ausnahme bildete das kollektive Hockergrab mit 12 Toten von Spreitenbach, das an Westschweizer Tradition anknüpfte. Gräber der Glockenbecherzeit sind in Allschwil und Riehen bekannt, wo die Toten einzeln in Hockerstellung bestattet waren, sowie in Sitten-Petit Chasseur.
Zwischen 4300 und 2800/2700 v. Chr. sehen wir gröbere Keramik, die mit einer Reduktion der Formenvielfalt bis auf den Kochtopf einherging, bis neue Einflüsse aus Mitteleuropa diese Entwicklung wieder umkehrten. Die Formen der Schnurkeramik bildeten die Grundlage für die weitere Entwicklung während der Bronzezeit. Der Wechsel vollzog sich bei der Keramik in der Ost- und Zentralschweiz abrupt, bei den Steinbeilen und ihren Schäftungen in Hirschgeweih und Holz aber gar nicht, so dass allem Anschein nach kein kultureller Bruch vorliegt oder gar ein Bevölkerungswechsel. In der Auvernierkultur kann man den westlichen und östlichen Einfluss genauer auseinanderhalten. Es entstand eine Mischkultur, bei der die autochthonen Elemente aus der Lüscherzer Kultur gut von den schnurkeramischen zu unterscheiden sind. Bei den Steinbeilen kam in der Westschweiz die mitteleuropäische Knieholmschäftung auf; auch die vielen Lochäxte kamen von dort. Die Entstehung der Mischkultur des Auvernier cordé könnte mit einer Zuwanderung einhergegangen sein.
Die Nordschweiz und das mittlere Juragebiet weisen viele Fundkomplexe mit Dickenbännlispitzen auf, aber kaum Keramikscherben. Die besagten Spitzen sind nach Vergleichsfunden in der Ostschweiz ab etwa 4500 v. Chr. bis ins 4. Jahrtausend v. Chr. zu datieren. Die Dickenbännlispitzen wurden als Bohrer für die zahlreichen Kalkröhrenperlen gedeutet, die eine Rolle im überregionalen Tauschhandel spielten.
Diese Phase, im übrigen Europa als Spätes Neolithikum aufgefasst, war eine wesentlich kriegerischere Zeit, als die früheren neolithischen Epochen. Dazu passt, dass die ersten Bauern kaum genetische Spuren in der mitteleuropäischen Bevölkerung hinterlassen haben, während die Erbauer der Kreisgrabenanlagen sich hierin durchsetzten, wie Joachim Bauer anhand genetischer Untersuchungen glaubt nachweisen zu können. Die Gruppen, die sich durchsetzten, konnten demnach Milchprodukte vertragen, so dass mehr ihrer Nachkommen überlebten.
Spätes keramisches Neolithikum (2400-2200 v. Chr.), Glockenbecherkultur, Übergang zur Bronzezeit
In diese Zeit fällt die Glockenbecherkultur, deren Spuren sich in der ganzen Schweiz mit der Ausnahme Graubündens fanden. Der stratigraphische Befund von Wädenswil Vorder Au belegt, dass die ersten Glockenbecher um 2425 v. Chr. noch im Rahmen der späten Schnurkeramikkultur auftraten. Die Glockenbecherkultur ist die Fortsetzung der Schnurkeramik. Die kulturelle Vereinheitlichung der Schweiz mit Ausnahme Graubündens könnte mit der Keltisierung in Zusammenhang stehen. Dass in diesen Gebieten Kelten gelebt haben, ist aber erst durch Inschriftenfunde der späten Eisenzeit und durch die Überlieferung der Römerzeit gesichert. Der Übergang von der Glockenbecher- zur Bronzezeit erfolgte kulturell kontinuierlich.
Mit dem Neolithikum erscheint erstmals die Nahrungsmittelproduktion, nicht mehr Suche und Jagd. Der Ackerbau trat dabei vor der Viehzucht und der Keramik auf. Saatgut und Tiere müssen eingeführt worden sein, weil die angebauten Pflanzenarten (Getreide, Lein, Erbse und Linse) und einige der Haustierarten (Schaf und Ziege) nicht in Mitteleuropa heimisch waren.
Der Ackerbau wurde nur sehr langsam intensiviert, im präkeramischen Neolithikum ist keine Änderung der Lebensweise anzunehmen, da keine Häuser nachgewiesen sind. Erst im frühen keramischen Neolithikum gehörten Steinbeil und Häuser zur kulturellen Ausstattung und belegen eine gewisse Sesshaftigkeit. Ab etwa 3500 v. Chr. können wir mit größeren Feldern mit kurzer Brache rechnen, auf denen auch das Vieh weidete. Die ersten Haustiere sind im keramischen Neolithikum nachgewiesen. Zugtiere, Joch und Pflug, die auf eine Intensivierung der Bodenbearbeitung hinweisen, gibt es ebenfalls ab etwa 3500.
Dass bis dahin Ackerbau und Viehzucht noch umkehrbare Entwicklungen darstellten, zeigt die Reaktion im Mittelland auf die Klimakrise der Jahre um 3700-3600 v. Chr. Man steigerte kurzerhand den Anteil der Jagd um ein Mehrfaches. Erst ab dem keramischen Neolithikum ist die Handmühle mit Unterlagstein und Läufer belegt. Da in der Schweiz keine Mörser bekannt sind, bleibt die Form der Getreideverarbeitung im präkeramischen Neolithikum unklar. Die Ernte erfolgte in den Siedlungen des Wauwilermooses mit Erntemessern oder Sicheln mit schräg eingesetzter, scharfer Klinge. Der Egolzwilzeitlichen Siedlung Egolzwil 3 folgte der Typ mit abgedrehtem Halmfänger aus Egolzwil 4 (Zürich-Hafner) sowie der wesentlich einfachere Typ mit langem Griff aus Egolzwil 5 (Zürich-Seefeld). Dagegen wiesen die Messer der Horgener Kultur, wie in der Westschweiz, nur noch einen kurzen Griff mit Aufhängeöse auf. Dies lässt auf eine bodennahe Ernte schließen. Endneolithische Erntegeräte wurden noch nicht entdeckt.
Regionale Unterschiede zwischen West- und Ostschweiz bestanden bei der Auswahl der angebauten Getreidearten und Tiere. So hielt man in der Westschweiz und dem Wallis mehr Schafe und Ziegen als in der Ostschweiz und in Graubünden, und in der Ostschweiz wurde mehr Emmer als in der Westschweiz angebaut.
Als Neuerungen traten neben dem Joch und dem Pflug ab 3200 v. Chr. die ersten Wagen auf. Der wichtigste Fund sind drei Räder und eine Achse von Zürich-Pressehaus aus der Schnurkeramik. Einige befestigte Zugangswege zu den Ufersiedlungen weisen auf entsprechenden Wegebau hin, am ältesten ist derjenige von Marin-Les Piécettes (3500-3400 v. Chr.).

Seen und Flüsse waren sehr wichtige Transportwege, Einbäume sind in der Schweiz ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. belegt (Männedorf, Hauterive-Champréveyres). Ersterer wurde 1977 geborgen, war mindestens 6 m lang, bestand, wie die meisten Einbäume, aus Lindenholz, und wurde auf 4450–4240 v. Chr. datiert.35
Das Steinbeil erschien ab Beginn des keramischen Neolithikums. Da große Silexknollen in der Schweiz selten sind, fertigte man sie aus Serpentinit an. Nur die Beile, die zwischen 4000 und 3600 v. Chr. aus den Vogesen eingetauscht wurden, bestanden aus Aphanit, wie es oft fälschlicherweise identifiziert wird. Es handelt sich jedoch um Pelitquarz. Bereits seit 5000 v. Chr. wurde Knotenschiefer vom Markstein bei Saint-Amarin (Département Haut-Rhin) und ab etwa 4400 v. Chr. Pelitquarz vom Tête Ronde bei Plancher-les-Mines (Département Haute-Saône) zunehmend abgebaut. Sie konnten sich jedoch lange nicht gegenüber den begehrten dreieckigen Prunkbeilen aus Jadeit, Omphacit und Eklogit duchsetzen, die aus Nordwestitalien kamen, insbesondere vom Monviso in den Cottischen Alpen und dem Monte Beigua im Apennin. Sie wurden bis nach England und Dänemark gehandelt. Da die Stücke aus den Vogesen immer stärker nachgefragt wurden, ging man dort ab etwa 4100 v. Chr. zu einer Art Massenfabrikation über. Früh dominierten die beiden Stellen den Handel im Oberelsass bzw. um die Burgundische Pforte, wo zwischen 4100 und 3800 v. Chr. etwa 80 % der Beile von den besagten Vogesenabbaustätten stammten. Doch auch um den Zürichsee stammten noch 60 % von dort, ebenso wie an den Seeufersiedlungen Hornstaad IA (3917-3909 v. Chr.) und Sipplingen B (3857-3817 v. Chr.) am westlichen Bodensee. Beile aus den Vogesen finden sich im östlichen Pariser Becken, in Luxemburg und im Jura, womit sie im Umkreis von 300 km vorkamen. Auf einer Fläche von einem Hektar wurden in Saint Amarin 2000 m³ abgebaut, in Plancher-les-Mines 6 bis 8000 m³. An beiden Stätten ging die Produktion nach 3800 v. Chr. rapide zurück, zwei Jahrhunderte später wurde die Produktion weitgehend eingestellt.35d
Das Beil ermöglichte den Hausbau, der besonders in der Bandkeramik kurz vor 5000 v. Chr. mit den Langhäusern gewaltige Dimensionen erreichte. Solche Häuser sind im Kanton Schaffhausen nachgewiesen. Der Knieholm war dabei in der Ostschweiz verbreitet. Er kam erst während der Schnurkeramik auch in der Westschweiz auf und war danach für die Bronzezeit typisch. Der Flügelholm hingegen war eine Westschweizer Form, die aber auch in der Zentralschweiz dominierte. Die Hirschgeweihfassungen sind ab 3800 v. Chr. in der Westschweiz häufiger geworden, kamen jedoch in der Zentral- und der Ostschweiz bis etwa 3000 v. Chr. kaum vor.
Die ersten Menschengruppen, die um 6500 v. Chr. in der Schweiz Getreide anbauten, lebten vermutlich noch vollständig als Wildbeuter, so dass am ehesten eine egalitäre Gesellschaftsstruktur zu vermuten ist. Dabei sind kleine territoriale Gruppen von etwa 50 bis 100 Angehörigen zu erwarten. Das Mittelland umfasst etwa 10.000 km². Wenn man für 6500 v. Chr. von etwa 5.000 Menschen ausgeht, dann hätten etwa 50 bis 100 Gruppen dort gelebt. Aus einer Ranggesellschaft entstand schließlich eine stratifizierte Gesellschaft, da Ackerbau und Viehzucht die Akkumulation von Vorräten ermöglichten - und damit die Frage der Verfügbarkeit über die Ressourcen. Verstärkt wurde diese Tendenz sicher durch das Aufkommen des Kupfers um 4000 v. Chr., auch wenn die Verteilung der Gusstiegel in der Pfyner Siedlung von Zürich-Mozartstrasse im 37. Jahrhundert vermutlich recht gleichmäßig ist, d.h. viele Leute Zugang zum neuen Metall hatten. Die größte Grabkiste aus dem Gräberfeld in Lenzburg (43. Jahrhundert) hatte als einzige einen Plattenboden. Der Tote war körperlich der größte, er lag allein und hatte die meisten Beigaben.
Aus dem früheren Neolithikum sind etwa doppelt so viele Gräber pro Jahr bekannt wie aus der Zeit zwischen 3000 und 2200 v. Chr. Anscheinend erhielt nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung ein Grab, wie dies auch für die Bronze- und Eisenzeit in der Schweiz gilt. Ein spezielles Phänomen ist das Kollektivgrab (wohl für Familien) - meist in Steinkisten oder Dolmen -, das in der Westschweiz, in der Zentralschweiz bis zur Limmat (Spreitenbach) und in der Nordschweiz bis zur Länge von Basel (Laufen, Aesch) vorkam.
Cortaillod-, Egolzwiler und Pfyner Kultur (Wallis, Zentral- und der Westschweiz)

Die Schweiz war im Neolithikum archäologisch sehr kleinteilig gegliedert.
Die Egolzwiler Kultur entstand gleichzeitig mit dem Cortaillod ancien der Westschweiz und der Rössener Kultur in der Ostschweiz um 4300 v. Chr. Erstere geht um 4000 v. Chr. im Zentralschweizer Cortaillod auf. Diese Kultur wiederum war Teil der Chassey-Lagozza-Cortaillod-Kultur (4600-2400 v. Chr.), die im Gebiet von der französischen Kanalküste über die Westschweiz bis zum Mittelmeer und weit nach Oberitalien, punktuell sogar bis weit in den Süden Italiens fassbar ist. Sie folgte im westlichen Mittelmeer der Cardial- oder Impressokultur. Das klassische Cortaillod der Zentralschweiz dauerte bis etwa 3900, im Westen bis 3500 v. Chr. Der Typ Cortaillod Port-Conty am Neuenburgersee reichte sogar bis 3300 v. Chr. Cortaillod und Pfyner Kultur wurden durch die Horgener Kultur abgelöst.
Bandkeramik, Großgartach, Rössen, Lützengüetle, Pfyn im Osten
Die Bandkeramische Kultur ist die älteste archäologische Kultur des Neolithikums in der Nordschweiz. Sie ging anscheinend aus dem Starčevo-Körös-Komplex hervor,37 der sich zwischen Südungarn, Nordserbien, Nordkroatien und Teilen Bosniens belegen lässt. Die Bandkeramik erreichte die nördlichen Lössgrenzen in Mitteleuropa ab 5600 bis 5500 v. Chr.
Auf der anderen Seite stehen Einflüsse der ältesten westmittelmeerischen neolithischen Kultur, der Cardial- oder Impressokultur, aus der sich die La-Hoguette-Gruppe ableiten lässt. Die Rhone aufwärts verbreitete sie sich um 6500 v. Chr. und erreichte etwa 300 Jahre vor der Linearbandkeramik den Rhein und sein Einzugsgebiet bis zur Lippe. Der Anteil von Haustierknochen ist an den Fundstätten der La-Hoguette-Kultur erheblich größer als bei den Bandkeramikern, da es sich um eine Hirtenkultur handelte, und die Bandkeramiker betrieben umgekehrt deutlich mehr Feldbau. Da Kontakte beider Kulturen belegt sind, ist es möglich, dass die La-Hoguette-Hirten und die Bandkeramik-Bauern wirtschaftlich und kulturell voneinander Vorteile erlangten.38
Vasi a bocca quadrata, Lagozza im Süden
Die Rössener Kultur, benannt nach einem Gräberfeld in Rössen (Sachsen-Anhalt), war um 4600-4200 v. Chr. im westlichen Mitteleuropa verbreitet. Sie berührte das Gebiet der Schweiz nur an ihrem Nordrand.
Die im Tessin vertretene Lagozza-Kultur, benannt nach einer Pfahlbausiedlung bei Mailand, ist Teil der übergreifenden Chasséen-Lagozza-Cortaillod-Kultur. Im Unterschied zu den oberitalienischen Gruppen der Vasi a bocca quadrata fand man bei der Schweizer Chamblandes-Gruppe mit ihren Steinkistengräbern und ihren persönlichen Schmuckbeigaben besonders bei Frauen und den Jüngeren nicht nur regionale Varianten, wie etwa zwischen dem Aosta-Tal und dem Schweizer Wallis bzw. dem Gebiet um den Genfer See. Während Aosta und Wallis nur Armreifen aus Glycymeris und Charonia-Muscheln aufweisen, fand man am Genfer See Wildschweinzähne, Anhänger mit besagten Muscheln und Glis type buttons. So könnte es sich bei den Angehörigen der Chamblandes-Gruppe um Anzeichen einer ethnischen oder Stammeszugehörigkeit handeln.39 Vielleicht geht dies auf mesolithische Traditionen zurück.40
Horgener Kultur (Westschweiz) als Ausläufer der Seine-Oise-Marne-Kultur
Zwischen 3400 und 2800 v. Chr. lässt sich die Horgener Kultur im südlichen Baden-Württemberg und auf dem Gebiet der Schweiz belegen, sieht man vom Tessin und vom Gebiet um Genf ab. Diese Kultur folgt in der Westschweiz auf die Cortaillod-Kultur, in der Ostschweiz und im Norden auf die Pfyner Kultur. Sie gilt als östlichster Ausläufer der Seine-Oise-Marne-Kultur in Frankreich und wurde nach dem Fundort Horgen-Scheller am Zürichsee benannt. Dabei ging man von einer großen Einheitlichkeit des Horgen aus, doch Keramikfunde zeigen größere Unterschiede. Das westschweizerische frühe Horgen wird dementsprechend auch Lattrigen, das späte Horgen Lüscherz genannt - letzteres weist wieder stärkere Kontakte nach Westen auf, dazu zwar gleichfalls grobe Keramik, doch hier kam wieder rundbodige Ware auf. Nach dieser Einteilung heißt die entsprechende Kultur im Bodensee-Ostschweiz-Gebiet Sipplingen, im Oberrheintal Tamins, schließlich Horgen in der Zentralschweiz, wo die namensgebende Fundstelle liegt. Wie gesagt: verwirrend.
Die Horgener Kultur - der Begriff der archäologischen Kultur wurde früher fälschlicherweise mit Völkern oder Stämmen assoziiert, daher entsprach jede kulturelle Veränderung einer Migration, am liebsten einer Unterwerfung oder Vertreibung - ist durch Feuchtbodensiedlungen und Pfahlbauten gekennzeichnet, vor allem aber durch grobe, dickwandige, zylinderförmige Keramik. Wie Speisereste in der Keramik belegen, wurden die dickwandigen Gefäße auch für das Erhitzen von Speisen verwendet, nicht nur zum Lagern. Da diese Art von Keramik die Horgener Kultur von ihren Vorgängerkulturen unterscheidet, kam die Vermutung auf, dass die Träger dieser Kultur Zuwanderer gewesen seien. Doch deuten Funde in Sipplingen auf einen kontinuierlichen Kulturwandel hin, was die Vermutung nahelegt, dass die Horgener Kultur in situ entstand. Versuche von Tieren, Pflanzen oder Menschen DNA zu gewinnen, sind bei der Horgener Kultur bisher gescheitert.42
In dieser Zeit ließ in vielen spätneolithischen Kulturen die Metallverarbeitung nach, darunter auch in der Horgener Kultur. Dies wurde vielfach darauf zurückgeführt, dass die leicht erreichbaren Erzfelder erschöpft waren. Eine Ursache könnte aber auch in einer Veränderung der materiellen Kultur liegen. Erst relativ spät, um 2000 v. Chr., setzte die Verarbeitung von Zinn und Kupfer zu Bronze ein.
Die Fußböden der Häuser, die bis dahin mit Lehm oder Seesedimenten gelegt wurden, bestanden nun aus Moos und Holz.43 Nun lassen sich Bezirke für Weber, Töpfer und Schmiede in den Dörfern nachweisen. Funde von Kämmen, Tierzahnanhängern und Mamorflügelperlen belegen ein ausgeprägtes Schmuckbedürfnis. Im Vergleich zu den Seen des Jura sind die Schmuckanhänger der Zentralschweiz weniger vielfältig. Charakteristisch sind Anhänger aus den Eck- und Schneidezähnen von Schweinen sowie aus Bäreneckzähnen. Dabei sind beide Typen von Eckzahnanhängern, ähnlich wie die einfachen Geweihsprossenanhänger mit distaler Öse vom Jung- bis zum Spätneolithikum belegt. Auch Kalksteinperlen, sowohl frühe als auch späte Typen kamen vor, Steinanhänger waren vor allem im Spät- und Endneolithikum geläufig, genauso wie Schmuckanhänger aus Schnecken- und Muschelschalen. Ein Beutel mit Muschelschalenanhängern stammt bereits aus der früh-jungneolithischen Siedlung Egolzwil 3 im Wauwilermoos.
Bei Seekirch-Stockwiesen in Oberschwaben entdeckte man Überreste von hölzernen Rädern. Sie besaßen viereckige Naben, woraus sich schließen lässt, dass die Radachse während der Fahrt rotierte. Die gut erhaltenen Räder belegen, wie die Räder nach und nach verbessert wurden. Sie entstanden nach 3000 v. Chr.43r
Bronzezeit (2200-800 v. Chr.)

Die Bronzezeit erstreckt sich von 2200 bis 800 v. Chr.44 Dieses frühe Einsetzen der Bronzezeit hat sich erst nach und nach in der Forschung durchgesetzt. Noch in seiner Urgeschichte der Schweiz von 1901 setzte Jakob Heierli die ältesten bronzezeitlichen Funde zwischen 1400 und 1250 v. Chr. an, die jüngsten zwischen 1000 und 700 v. Chr.45 Erst 1962 begann mit dendrochronologischen Untersuchungen an der Seeufersiedlung Zug-Sumpf eine genauere und erheblich frühere zeitliche Zuordnung. So lässt sich inzwischen die Schlussphase der Frühbronzezeit und die jüngere Spätbronzezeit mit dem Kalender korrelieren. Die Zeitabschnitte vor und zwischen diesen Ufersiedlungen werden mit der Radiokohlenstoff-Methode datiert, wenn sie auch ungenauer ist.
Nur wenig jenseits der Grenze nach Deutschland, bei Bad Buchau im Gebiet des Federsees, waren die Arbeiten der urgeschichtliche Archäologie des Federseebeckens besonders ertragreich, wo eine wohl einmalig dichte und lange Besiedlung Forschungen über einen Zeitraum von fast 4000 Jahren zulässt. Die überaus vielfältigen Funde sind auf die außergewöhnlichen Erhaltungsbedingungen zurückzuführen und reichen vom 7000 Jahre alten Weizenkorn über Einbäume und die weltweit ältesten neolithischen Räder bis hin zu Gefäßen, die Anlass zur Definition mehrerer Kulturen gaben. Schon für 11.000 v. Chr. ließen sich Rentierjäger am Federsee nachweisen, im Endmesolithikum fanden sich aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends mit der „Bad Buchauer Gruppe“ erste Zeichen einer beginnenden Sesshaftigkeit (Henauhof Nord II). Doch zwischen spätem Neolithikum und früher Bronzezeit sowie zwischen mittlerer und später Bronzezeit weist das Gebiet zwei recht große Fundlücken auf; Schnurkeramik und Glockenbecherkultur fehlen ganz. Erst mit dem Ende der Feuchtbodensiedlungen um 720 bis 610 v. Chr. endet diese lange Sequenz von Kulturen. Der lange währende Streit, ob es sich nun um Pfahlbauten im Wasser oder Feuchtbodenbauten auf dem Niedermoor handelte, gilt inzwischen als erledigt, da beide Bauformen zeitweise vorteilhaft waren, ja, sogar als Folge von Überflutungen teilweise nebeneinander vorkamen. Dabei haben sich sicherlich und je nach Uferlage und Seehochstand insulare oder Uferrandsituationen unterschiedlicher Struktur ausgebildet, die einander abwechselten.
Dabei bildete das Wallis und das Waadtländer Chablais, wie sich an Grabfunden zeigen lässt, während der frühen Bronzezeit (2200-1550 v. Chr.) eine in vielerlei Hinsicht innovative Region. Die Genferseeregion unterhielt weiterhin intensive Kontakte in das mittlere Rhonebecken und war auch mit Savoyen verbunden, ein Großraum, der die Rhonekultur bildete. Die Region der drei Juraseen bildete ebenfalls einen zusammenhängenden kulturellen Raum, zumal hier günstige Voraussetzungen für Ackerbau und Viehzucht sowie eine günstige Verkehrslage am Jurafuß bestanden. Von hier aus bestanden Verbindungen zur Saône (Franche-Comté), zum Genfersee und die Aare entlang zum Rhein. Dank dieser günstigen Verkehrslage fand hier ein intensiver Güterverkehr statt. Der Nordwesten der Schweiz bildete in der Spätbronzezeit einen integrierenden Teil des Oberrheingebiets. Die Bodenseeregion und das Thurtal blieben Richtung Hegau und zum Donautal offen, die wohl wichtigste Konstante. Zwar orientierte sich die Bevölkerung am Zürichseebecken dann und wann nach Nordosten, doch saß die Region eher in einem Beziehungsnetz in alle Richtungen. Ähnliches gilt für die Zentralschweiz, von wo aus Verbindungen zum Zürichsee und zum Aargau bestanden, eine Ausrichtung, die in der Spätbronzezeit auch westwärts reichte. In der Südschweiz sind aufgrund mangelnder Forschung nur Tessin und Misox, und auch nur in der Spätbronzezeit, als Siedlungsgebiete fassbar. Das Tessin stand mit der westlichen Lombardei und dem Piemont mit der Canegrate-Gruppe in Beziehung, einer Vorstufe der Golaseccakultur. Dieser südliche Einfluss reichte bis ins Wallis, ja bis Freiburg und ins Aaretal, wobei von dort auch Güter in den Süden gelangten. Das Engadin wiederum war mit Südtirol kulturell und wohl auch durch Handel eng verflochten. Es bestanden Beziehungen zu Nordbünden und dem Alpenrheintal, fassbar in der Melauner Kultur.
Zwischen etwa 1500 und 1200 v. Chr. und zu Beginn des 1. Jahrtausends kam es zu längerfristigen klimatischen Verschlechterungen, das heißt kühlerem und nasserem Wetter (Göschenen 1). Dabei stieg der Wasserspiegel der Seen drastisch an, so dass viele Siedlungen aufgegeben werden mussten. Im Gegensatz dazu kam es in den inneren Alpen zu einer Siedlungsexpansion. In der Po-Ebene führte eine starke Trockenphase um 1150 v. Chr. zum Ende der Terramare-Kultur. Während das 2. Jahrtausend also insgesamt von eher günstigen Bedingungen geprägt war, führte ein um 1450 v. Chr. einsetzender Temperaturrückgang zu Gletschervorstößen und zu Veränderungen des Wasserstandes (Löbben-Schwankung, nach einem Gletschervorstoß in Osttirol). Ein weiterer Gletscherhochstand um 1200-1100 v. Chr. ging den spätbronzezeitlichen Seeufersiedlungen voraus. Um 750 ereignete sich zu Beginn der Hallstattzeit ein abermaliger Kälteeinbruch. Das Siedlungsnetz verdichtete sich bis dahin, in der späten Bronzezeit entstanden erstmals Siedlungen von 1-2 ha Fläche.
Nach einer längeren siedlungsleeren Zeit an den Mittellandseen lassen sich ab 1900 v. Chr. Uferdörfer fassen. Zwischen 1680 und 1500 v. Chr. nahm ihre Zahl erheblich zu, wenn die Dörfer auch weiterhin recht klein blieben. Dabei stellt Arbon-Bleiche im Kanton Thurgau mit 0,5 ha noch die größte erforschte Siedlung dar. Wichtig ist daneben der Fundplatz von Concise im Kanton Waadt. Dörfer entstanden häufig an strategisch günstigen Stellen. Ihre Holzhäuser zeigen regionale Unterschiede. So wurden vom Baldegger- bis zum Bodensee stabilisierende Fundamentplatten, ‚Pfahlschuhe‘ genannt, zum Einsatz, die in der Westschweiz fehlen. An den Juraseen und am Genfersee bilden Holzpfosten die einzigen erhaltenen Bauelemente. In Zürich-Mozartstrasse konnte man in drei Reihen angeordnete und anscheinend in zwei Räume aufgeteilte Häuser mit einem Schwellbalkenrahmen und 5,5 m hohen Firstpfosten nachweisen.
Zu den Hauptmerkmalen dieser Epoche Mitteleuropas, der Bronzezeit, gehört ein geometrischer Stil, während Bilder von Lebewesen, im Gegensatz zu Skandinavien, kaum vorkommen. In der Westschweiz fanden sich einige Tontiere, die ebenso wie die Rasseln in Vogelgestalt vielleicht bei Ritualen oder Festen Verwendung fanden.
Zwischen 1500 und 1050 scheint es, als ob sich die Bevölkerung des Mittellands in einer Streusiedlungsweise verteilt habe. Dabei wurden die Siedlungsstandorte an den Seen anscheinend zurückversetzt, wie etwa in Erlenebach und Cham in den Kantonen Zürich und Zug. Erstere Siedlung aus der mittleren Bronzezeit liegt auf der ersten Terrasse, 60 m über dem heutigen Seespiegel, während sich diejenige von Cham-Oberwil 3,5 km vom See entfernt in einer Drumlinlandschaft befindet. Charakteristisch sind Steinschüttungen, die den Baugrund oder die Zirkulationszone befestigen sollten. Solche Drumlins bestehen aus länglichen Hügeln von tropfenförmigem Grundriss, deren Längsachse in der Eisbewegungsrichtung eines Gletschers liegt.
Siedlungen wurden zum Teil in großer Höhe angelegt, wie in Graubünden das wohl nur zeitweilig bewohnte Boatta Striera in 2003 m Höhe (S-chanf). Andere Bautypen als im Mittelland sind Ausdruck des völlig anderen Klimas. Auf dem Hügel Padnal bei Savognin an der Julierroute standen in drei Reihen angeordnete Häuser mit einem Steinsockel; ob es sich um Blockbauten oder Ständerbauten mit Balkenfüllung handelte, ist unklar. Ihre Räume bargen große Herdstellen oder Öfen.
Manche Siedlungen markierten eher eine Art Territorium, wie die Hügelfestung Friaga Wald in Bartholomäberg im Vorarlberger Montafon-Tal. Die bebaute Hügelspitze bot nur eine Fläche von 1000 m². Sie war künstlich terrassiert und im 16. Jahrhundert v. Chr. mit einer 80 m langen, 2-3 m dicken Steinmauer umgeben. Auf dem Hügel standen ansonsten nur fünf bis acht Blockhäuser. Wenig später entstand ganz in der Nähe eine große und offene Siedlung auf der Platta-Terrasse.46
Solcherlei Art von Befestigung lag in einem geradezu europaweiten Trend. Dieser hängt möglicherweise mit früher Kupfererzgewinnung, aber auch mit dem transalpinen Handel zusammen. Einige Siedlungen dienten anscheinend eher der Versorgung, andere deutlich der Verteidigung, wie die burgartige Felsenfestung von Hohenrätien am Eingang zur Viamalaschlucht auf der Sankt-Bernhard-Route.
Auf den Strandplatten der Mittellandseen, die tiefe Wasserstände aufwiesen, begann um 1060 v. Chr. eine erneute Bautätigkeit. Die meisten Uferdörfer waren von Zäunen umgeben, die seewärts gerichteten Zäune dienten nur der Abwehr hoher Wellen, nicht der Verteidigung. Einige Dörfer waren nun über 2 ha groß, wie Morges-Grande Cité, Grandson-Corcelettes, Zürich-Wollishofen und Zürich-Alpenquai. In der Grande Cité wurde ein Einbaum aus Eichenholz etwa auf der Höhe der 1854 entdeckten Siedlung gesichtet und 1877 zur Hälfte geborgen.47 Etwa 100 m weiter nördlich liegt die spätbronzezeitliche Siedlung Vers-l'Église, die bis in die Zeit zwischen 2900 und 2700 v. Chr. zurückreichte. Nordöstlich der Grande-Cité liegt die dritte Seeufersiedlung, Les Roseaux, deren erste Besiedlung in die frühe Bronzezeit fällt. Hier fanden sich Randleistenbeile aus Bronze und Tassen aus Feinkeramik (Typ Roseaux). Wie Untersuchungen an der Siedlung Zug-Sumpf 1 erwiesen, verschlangen diese Orte im Laufe ihrer Existenz große Mengen Holz. In diesem Falle waren dies 8500 bis 9000 große Baumstämme. Hinzu kamen etwa 600 Tonnen Lehm für Wände, Herde oder Tongefäße.48
Anders sahen die Siedlungen am Neuenburgersee aus, wo man kleinere, kompakte Dörfer mit rechtwinklig angeordneten Häusern und engen Gassen bevorzugte. Größe und Baustruktur variierten aber innerhalb der Regionen sehr stark. Nun konnten einzelne Befestigungsanlagen, wie die auf dem Montlingerberg bei Oberriet im Kanton St. Gallen, in die Spätbronzezeit datiert werden.
Spätestens in der Spätbronzezeit, deren genauer Beginn ebenfalls noch diskutiert wird, und die einige Forscher bereits um 1325 v. Chr. beginnen lassen, entstand eine Dörferhierarchie, wie die im unteren Zürichseebecken. Dort wurden offenbar zwei Inselsiedlungen in der Umgebung des Ausflusses durch mehrere Dörfer am Ufersaum versorgt, denn auf den Seekreideböden konnte kein Getreide angebaut werden.
Dabei finden sich nur wenige Belege für soziale Unterschiede. Von der Früh- bis zur Spätbronzezeit gliedern sich die Gräber, an denen diese Hierarchie am ehesten zu erkennen ist, nach Anlage und Ausstattung in drei Klassen. Zum einen sind dies Bestattungen in abgesonderter Lage oder mit markierenden Grabbauten, entweder als Steinpackungen oder als Erdhügel. Zu dieser höchsten Kategorie gehören etwa die drei Gräber, die sekundär in und neben der spätneolithischen Megalithgrabanlage VI von Sitten eingebaut wurden. Eines dieser Gräber passt sich mit seinem reichen Schmuck und den Waffen in die mitteleuropäische Oberschichtsvorstellung ein. Bestattungen ohne metallene Beigaben sind jedoch weit zahlreicher.
Bronze, in geringem Umfang auch Gold, wurden geläufige Mittel zur Darstellung und Abstufung gesellschaftlicher Positionen. Diese Funktion erfüllten während der Frühbronzezeit etwa die verzierten Dolche mit Bronzegriff und die als Kopf- oder Brustschmuck getragenen, ebenfalls verzierten Blechbänder. Die entsprechende Produktions-Infrastruktur entstand in der Schweiz erst in der späten Frühbronzezeit in größerem Umfang. Nun begannen Arbeitsgeräte aus Bronze die bis dahin gewohnten Steingeräte abzulösen. Ein hochgradig spezialisiertes Spektrum einer Vielzahl von Metallwerkzeugen ist schließlich für die Spätbronzezeit kennzeichnend. Da Kupfer- und besonders die Zinnlagerstätten in Europa sehr ungeleichmäßig verteilt sind, war zur Beschaffung der beiden Metalle ein weiträmiges Handelsnetz vonnöten.
Die offenen Landflächen nahmen im Laufe des 2. Jahrtausends auf Kosten des Waldes weiter zu. Ob nun mangels nahegelegener Waldweiden bereits die Heufütterung eingesetzt hat, ist unklar. Beim Ackerbau scheint man dem Auslaugen der Böden mit Fruchtwechsel, Brache und Viehdung entgegengewirkt zu haben, wobei Weizen, Gerste und Hirse die Hauptgetreide waren. Hinzu kamen Bohnen und Linsen, Mohn und Flachs. Die Spuren früher Flursysteme wurden bedauerlicherweise vernichtet, so dass die Frage nach einer bronzezeitlichen Parzellierung, wie sie in Westeuropa nachgewiesen ist, offen bleiben muss.
Zwar wurden in Höhenlagen, die heute für die Alpwirtschaft genutzt werden, zahlreiche Geräte und Waffen - Beile, aber auch Dolche, Messer und Lanzenspitzen - gefunden, und auch Feuerstellen wurden in großer Höhe nachgewiesen, doch eine organisierte Alpwirtschaft mit saisonaler Transhumanz oder Wanderweidewirtschaft lässt sich nicht belegen. Die schwankende Waldgrenze befand sich rund 100 m über der heutigen. Kupferverhüttung konnte im Oberhalbstein belegt werden, so etwa in der Umgebung von Riom.
Selbst in kleineren Seeuferdörfern lässt sich nun ein Bronzegießer nachweisen, der Alltagsobjekte wie Ringe, Beile, Sicheln oder Messer herstellen konnte. Bei aufwändigeren Gütern wie Schwertern oder Bronzeblechgefäßen, die nur von einem Teil der Bevölkerung nachgefragt wurden, wird mit mobilen Spezialisten in einem wohl sowieso saisonalen Handwerk gerechnet. Luxusgüter aus anderen Regionen, so etwa Bernstein, Muschelperlenschmuck oder gar Glas, sind nur in geringen Mengen nachgewiesen. Sicherlich gehörten zu dem fest etablierten Vertriebssystem, das auch organische Güter wie feine Leinengewebe, aber auch Salz oder Vieh umfasste, entsprechende Infrastrukturen, die jedoch bisher kaum fassbar sind. Ob es sich beim Töpferhandwerk und der Herstellung von Textilien um rein häusliche Handwerke handelte, wie dies in der Schweiz meist angenommen wird, ist bisher nicht zu erkennen.
Auch während der Frühbronzezeit wurden einige Produkte serienweise hergestellt, mitunter zu Paketen gebündelt und in Gefäßen, Kisten oder Gruben gehortet - Tendenz steigend. Ringe bildeten eine bevorzugte Form, wobei die Gewichte oftmals recht eng um einen Mittelwert schwanken, so dass von einer Art Normung oder Absprache die Rede sein kann. Dies ist beispielsweise im Hort von Arbedo-Castione der Fall. Im spätbronzezeitlichen Seeuferdorf von Hauterive im Kanton Neuenburg wurden zwei Bündel aufgefädelter Bronzeringe gefunden, von denen das eine 250, das andere 400 g wog. Diese und weitere Ringe weisen meist Gewichte von 0,5-2 g bei Durchmessern von 7-26 mm auf. Solche Bündel waren in ganz Mitteleuropa im Umlauf. Sie wurden zwar gelegentlich zu Schmuckgehängen verbunden, doch scheint man sie daneben auch wie Münzgeld eingesetzt zu haben.
Zu der dahinterstehenden umfangreichen Güterzirkulation gehörten Einbäume, mit deren Hilfe der Transport abgewickelt wurde; Bohlenwege für Karren oder Wagen wurden bisher, im Gegensatz zu Norddeutschland oder England, noch nicht gefunden. Die Fundstreuung an tief eingeschnittenen Bachläufen deutet jedoch darauf hin, dass diese statt der Bohlenwege benutzt wurden, ähnlich wie an Passrouten. Die Gewichte der Hortfunde überstiegen in der Schweiz - im Unterschied zum Balkan - die von einem Menschen tragbare Größenordnung nicht. Die etwa 60 Beile von Sennwald-Salez wogen etwa 13 kg, der spätbronzezeitliche Rohmetallhort von Schiers 18,7 kg.
Eine Zäsur trennt das Bestattungsritual der frühen von dem der mittleren Bronzezeit. Abgesehen von wenigen Vorläufern wurden nun erst markierende Hügel aufgeschüttet, die meist mehrere Gräber von Angehörigen beiden Geschlechts und auch von Kindern bargen. Es handelte sich wohl um Familiengrabanlagen. Dabei erfolgte die Ausstattung mit Metallbeigaben bei den Erwachsenen aus wohlhabenden Familien überregional nach ähnlichen Regeln, mit klarer Differenzierung nach dem Geschlecht. Die im Neolithikum bzw. in der Kupferzeit ausgebildete Sitte, den Blick der Toten nach Osten, oder eher gen Sonnenaufgang zu richten - Männer auf der linken Seite liegend, mit dem Kopf im Norden, Frauen auf der rechten Seite, mit dem Kopf im Süden - bestand fort. Es sind Baumsärge und Leichentücher nachgewiesen. Auch die Grabbeigaben unterschieden sich weiterhin eindeutig nach dem Geschlecht der Toten.
Um 1350 v. Chr. änderten sich die Sitten erneut sehr weiträumig. Die vorher schon nachweisbare Verbrennung dominierte nun, ein sehr kleiner Teil der Oberschicht stach durch die Mitverbrennung eines mit Bronze beschlagenen Wagens auf dem Scheiterhaufen heraus. Dieses neue, in Süddeutschland verankerte Ritual konnte in der Schweiz in Saint-Sulpice, Bern-Kirchenfeld und Kaisten im Aargau nachgewiesen werden. Die Brandgräber waren oftmals mit Keramik ausgestattet, während die Metallbeigaben auf dem Scheiterhaufen landeten. Dabei bestanden zwischen den Landesteilen markante Unterschiede, denn Grabhügel wurden im Mittelland angelegt, Flachgräber und Körperbestattungen im Wallis, Brandbestattungen wurden in Graubünden durchgeführt. Ab der Spätbronzezeit dominierten Friedhöfe mit Einzelbestattungen und Brandschüttungsgräber in immer kleineren Grabgruben, in einigen Fällen mit Steinabdeckung. Die Asche der Toten wurde in Urnen gegeben (Urnenfelderzeit).

Ein bedeutendes Ritual stellte daneben die Versenkung von Schwertern und Lanzenspitzen im Wasser dar. Der Rhein lieferte beispielsweise bis hinauf nach Graubünden Belege für diesen Brauch, der sich von 1500 bis 800 v. Chr. belegen lässt, um dann zu verschwinden.
Die Kontrolle über den Metallhandel scheint zur Herausbildung von strukturierten Gesellschaften beigetragen zu haben, was sich im Obsidian- und Steinbeilhandel womöglich schon angekündigt hatte. Der Handel mit den Rohstoffen förderte weiträumige Kontakte, es entstand geradezu ein europäisches sozio-ökonomischen Netzwerk, in dem nicht nur Güter, sondern auch Menschen und Ideen „ausgetauscht“ wurden. Daher zeigen die Bronzegegenstände oder die Keramik starke kulturelle Einflüsse über große Distanzen, wie etwa aus dem mittleren Donauraum oder Oberitalien. Andererseits mussten die Wege, Lager und Händler offenbar geschützt werden, was zum Bau befestigter Anlagen und einem Anwachsen organisierter Gewalt zur Verteidigung der Ansprüche beigetragen haben dürfte.
Kelten, Eisenzeit (800-30 v. Chr.)
Zwar wird die nachfolgende Epoche als Eisenzeit bezeichnet, doch dieses Material veränderte die Lebensweise nur über längere Zeiträume. Auch die Bezeichnung als „keltisch“ gilt inzwischen als problematisch. Die Kelten waren keineswegs eine irgendwie geartete Rasse, ein Volk, sondern eher eine Sprachgruppe, die sich eines übergreifenden Idioms bediente, das sich allmählich bei einer Vielzahl von Gruppen durchsetzte.
Diese Kelten hatten weitreichende Handelskontakte, wie sich anhand der Grabausstattungen erkennen lässt. So kamen Helme aus Süditalien oder Waffen aus Griechenland, gelegentlich sogar Prunkwagen. Der Handel mit solcherlei Gütern dürfte den nun erkennbaren höhergestellten Kriegern hohes Prestige und Ansehen, Macht, aber auch Reichtum eingebracht haben. Eine der Handelsrouten führte über La Tène am Neuenburger See, einem Ort, der heute eine archäologische Kultur bezeichnet. Dort fanden ab 2003 erneut Grabungen statt.49
Die frühesten schriftlichen Zeugnisse zu den Helvetiern, nach denen die Schweiz auch Confoederation Helvetica genannt wird, stammen aus der Feder von Griechen und Römern. Mit ihnen erhalten wir eine erste Beschreibung, wenn auch als Fremdwahrnehmung, und eine, deren Schwerpunkte mitunter innenpolitischen Zielen dienten, wie im Falle Julius Caesars. Unumstritten ist, dass die Helvetier Gold zu Schmuck verarbeiteten, wie die frühen Quellen berichten und wie archäologische Funde bestätigen. So fand man 1961 im Kanton Uri Arm- und Halsringe, die nicht nur von hoher Qualität waren, sondern die auch der Ausfuhr dienten, besser gesagt dem archaischen Handel mit den Mittelmeerländern. Die Menschen siedelten auf Hügel um, denn die Wasserspiegel der Seen waren im Schnitt um zehn Meter angestiegen. Zudem bestand Verteidigungsbedarf, denn die Hügelsiedlungen wurden zu Fluchtburgen mit Ziegelmauern und Wällen ausgebaut.
Ab dem 3. Jahrhundert gerieten die Kelten, die mehrere Jahrhunderte lang in der Offensive waren, in die Defensive gegenüber den Römern. Die Berichte Caesars kennt in der Schweiz jeder Schüler. Als die Helvetier weichen mussten, hinterließen sie 58 v. Chr. zerstörte Siedlungen, Caesar erwähnt zwölf oppida, Weiler und Dörfer. Archäologisch nachgewiesen sind zwei solche Plätze auf dem Münsterhügel in Basel und auf der Engehalbinsel in Bern. So wie Caesar sie beschreibt, war die Familie der kleinste Kern der helvetischen Gesellschaft, die wiederum einem Clan mit seinen Leibeigenen und Klienten angehörte. Neben diesen Clanführern, deren Prestige unter anderem von der Zahl der Abhängigen bestimmt wurde, waren die Druiden von großer Bedeutung. Sie fungierten als Schlichter, bildeten aber auch die Jungen aus und mussten zudem den Willen der Götter erkennen und ihre Gewogenheit aufrechterhalten. Die Sippen verbanden sich gelegentlich zu Stämmen, die in Gaue untergliedert waren. Die mächtigsten Angehörigen der aristokratischen Führungsclans versuchten, so behauptet jedenfalls Caesar, die Königsherrschaft wiederherzustellen, die ihnen der Adel einst entwunden hatte. Folgt man Caesar, so gab es zu seiner Zeit 368.000 Helvetier. Von diesen Ausgewanderten kehrte ein Drittel wieder in die angestammten Gebiete zwischen Bodensee, Jura, Basel und Genf zurück, nachdem Caesars Legionen ihnen den Weg nach Südfrankreich versperrt hatten.
Hallstatt (800-480 v. Chr.)
Die nach dem Fundort Hallstatt im österreichischen Salzkammergut benannte Kultur dürfte das Substrat, aus dem in diesem Raum in den letzten Jahrhunderten v. Chr. die Kelten hervorgingen, gewesen sein.50 Am Anfang dieser Epoche standen klimatische Veränderungen, die das Ende der Siedlungen an See- und Flussufern einläuteten. Zugleich setzte sich Eisen als Werkmaterial durch.
Dabei wird anhand der Ausstattung der Gräber, etwa von Erdhügeln, aber auch der Grabsitten ein West- und ein Osthallstattkreis unterschieden. Während sich im Norden vor allem Gräber nachweisen lassen, sind es im St. Galler Rheintal, in Nord- und Mittelbünden sowie im Engadin Siedlungen - sieht man vom Gräberfeld von Tamins-Unterm Dorf am Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein ab, durch die wir über die Kelten unterrichtet sind.
Die Hallstattzeit wurde in vier Abschnitte eingeteilt. Heute jedoch gelten nur noch die Stufen C und D als Abschnitte der kurz vor 800 v. Chr. beginnenden Hallstattzeit, wobei C für die ältere Hallstattzeit, D hingegen für die Späthallstattzeit steht. Ganz anders sieht es in den alpinen Gebieten im Osten und Süden der Schweiz aus, denn dort dominiert der oberitalienische Einfluss, nicht der der Hallstattkultur. Daher zieht man dort den Begriff ältere Eisenzeit (prima età del ferro) vor. Inzwischen werden für die einzelnen Landschaften jeweils spezifische Stufen angewendet, denn regionale Gruppen herrschten weiterhin vor.
Dabei war der Norden mit den südwestdeutschen Gebieten verbunden, genauer gesagt der Nordwesten weiterhin mit dem Oberrheintal, der Nordosten mit den Gruppen im Hegau und im oberen Donaugebiet. Gefäßformen und der in den Gräbern gefundene Schmuck sowie das Kleidungszubehör belegen dies. Aus der Zentralschweiz sind hallstattzeitliche Funde nur aus den Kantonen Luzern und Zug bekannt. Eisenzeitliche Gefäßfragmente aus dem Alpenrheintal bzw. der Alpensüdseite aus Amsteg-Flüeli im Kanton Uri erweisen vielleicht, dass die Passübergänge, die das Reusstal mit dem Vorderrheintal und dem Tessin verbanden, zu dieser Zeit bedeutend waren.
Besonders intensiv war die Besiedlung um die drei Seen am Jurafuß. Landwirtschaft und weit ausgreifende Beziehungen zum Genfersee oder zum Rhein, aber auch durch die Juratäler nach Ostfrankreich bildeten weiterhin eine wichtige Grundlage. Trotz einer eigenständigen Entwicklung, vor allem im Metallhandwerk (Walliserringe), blieb das Wallis Richtung Westen wie Süden offen. Grabfunde erweisen ausgeprägte Bindungen des Unterwallis und des Chablais vaudois zum Genferseegebiet, Richtung Jura und zum Berner Mittelland, während das Oberwallis stärker oberitalienische Einflüsse offenbart. Zunächst war Nordbünden eng mit der Nordostschweiz verbunden, wenn auch Beziehungen zum Engadin und Südtirol bestanden. Im 6. Jahrhundert v. Chr. nahm der Einfluss der südalpinen Golaseccagruppen zu. Tessin und Misox waren gar integrale Teile der westlombardisch-piemontesischen Golaseccakultur. Das Engadin war mit Südtirol verbunden und zugleich mit Nordbünden und dem Alpenrheintal.
Die Helvetier genossen als Schmiede einen enormen Ruf. So soll um 400 v. Chr. in Rom ein keltischer Helvetier namens Helico gelebt haben, dessen Schmiedekünste weit und breit berühmt waren. Diese Episode scheint einen Kern historischer Wahrheit zu enthalten, denn das lateinische Wort für Schwert, gladius, stammt aus der keltischen Sprache.51 Trotz der zahlreichen Eisenvorkommen gibt es jedoch im Gebiet der Schweiz der Hallstattzeit keine Spuren einer Eisenverhüttung oder für Schmelzöfen. Hinweise auf Schmiedetätigkeiten stellen die in den Siedlungen von Russikon-Furtbüel oder Neukirch-Tobeläcker entdeckten Schlacken mit hohem Eisengehalt dar. Das harte Metall wurde nur selten zu Schmuck oder Kleidungszubehör verarbeitet. Es blieb überall den Männern vorbehalten und zwar als Statussymbol. Erst in der jüngeren Eisenzeit wurde Eisen wirtschaftlich extensiver genutzt. Zur Zeit des Helico gab es wohl demnach noch keine lange, extensive Tradition helvetischer Eisenverarbeitung.
Bronze blieb als das beste Metall für Schmuck, Arm- und Halsringe oder Fibeln, aber auch für Gefäße und Gürtelbleche die häufigere Wahl. Die Bronzeschalen und Bronzebecken, wie man sie in Corminbœuf-Bois Murat, Wohlen-Hohbühl oder Zollikon-Fünfbühl fand, dienten den Luxusbedürfnissen der oberen Schichten. Dies gilt auch für die italienischen Bronzeeimer, die Situlen und Zisten. Auch wurde das wertvolle Metall weiterhin gehortet, wie die 3.800 Stücke aus dem Depotfund von Arbedo zeigen. Nördlich der Alpen sind keine Depotfunde aus der frühen Hallstattzeit belegt.
Die Gesellschaft war keineswegs egalitär. Aufgrund des Vorhandenseins bzw. des Fehlens eines Wagens, von mediterranen Importen, Objekten aus Gold und Metallgefässen oder Waffen - Schwerter, später Dolche und Lanzen - lassen sich insbesondere die Männergräber aus den Grabhügeln mehreren Klassen oder Schichten zuordnen. Dabei ist festzuhalten, dass manchen Frauen der oberen Schichten eine gleichwertige Grabausstattung wie ihren Männern zukam. In der Nordostschweiz wurde offenbar Frauen häufiger als Männern ein Bronzegefäß als Beigabe ins Grab gelegt, gleich ob es sich um eine Situla, eine Rippenziste oder ein Bronzebecken handelte (Wohlen-Hohbühl, Russikon-Eggbühl, Bonstetten-Gibel, Zollikon-Fünfbühl). Die im Wagengrab von Gunzwil-Adiswil-Bettlisacker beigesetzte Frau, mit Beigabe einer Bronzesitula und im Besitz von Kopf-, Hals-, Arm- und Beinschmuck aus Gold, Gagat - ein durch Humusgel oder Bitumen imprägniertes fossiles Holz, das sich in einem Übergangsstadium von der Braunkohle zur Steinkohle befindet -, Bernstein und Bronze, gehörte sicher der obersten Gesellschaftsschicht des 6. Jahrhunderts an.52 Auch die bescheidensten Grabinventare aus der West-, Ost- und Zentralschweiz, die „nur“ aus Kleidungszubehör und Schmuck bestehen, sind keinesfalls als arm zu bezeichnen. Neben der Ausstattung wird auch die Lage eines Grabes als Kennzeichen der gesellschaftlichen Schichtung gewertet, etwa im Zentrum eines Hügels oder in der Hügelaufschüttung als Nachbestattung. Dies gilt allerdings erst für die Späthallstattzeit. Davor wurden die in Gruppen angelegten Gräber einzeln mit einem mehr oder weniger großen Erdhügel markiert (Unterlunkhofen-Im Bärhau). Ab dem Ende des 7. Jahrhunderts sind Großgrabhügel nachweisbar, die weitere Gräber von Mitgliedern eines Sozialverbandes bargen (Thunstetten-Tannwäldli, Wohlen-Hohbühl).
Besonders reiche Gräber wurden, analog zum Mittelalter, als „Fürstengräber“ bezeichnet, die befestigten Höhensiedlungen entsprechend als „Fürstensitze“. Diese Zuordnung ist jedoch strittig. So wurde das Grab von Eberdingen-Hochdorf in Baden-Württemberg, eines der reichsten im Gebiet des Westhallstattkreises und mit einem eindrucksvollen Hügel markiert, in unmittelbarer Nähe einer Landsiedlung angelegt, die der Vorstellung eines „Fürstensitzes“ in keiner Weise entspricht.
In der Südschweiz beziehen sich Unterschiede eher auf das Geschlecht als auf den Rang. Daraus lässt sich allerdings kaum auf eine egalitäre Sozialstruktur schließen, denn schon die Beigabe eines Metallgefäßes, auch wenn dieses meist die Funktion eines Leichenbrandbehälters hatte (Mesocco-Coop), könnte ein Anzeichen sein. Ähnliches gilt für Halsketten aus bis zu 80 Bernsteinperlen in Frauengräbern.
Zur Ausstattung reicherer Gräber gehörten Wagen aus Holz und Bronze oder Eisen mit Teilen des Zaumzeugs, dazu Eisendolche oder aus Goldblech gefertigte Halsreifen und Armringe, meist im bronzezeitlich-geometrischen Stil. Figürlich ausgestattete Bronzestücke, die im Osthallstattkreis und im Mittelmeerraum häufig anzutreffen sind, waren nördlich der Alpen und in den Südalpentälern sehr viel seltener.
Erstmals wurden Arbeiten an der Dreh- und Drechselbank durchgeführt, auf die präzise gravierte Linienbündel auf Tonnenarmbändern hinweisen. Diese Armbänder waren bis zu 20 cm breit.
Gegen Ende der Hallstattzeit wurde die schnell drehende Töpferscheibe übernommen. Spätestens jetzt wurde die Produktion von Tongefäßen aus dem häuslichen Bereich in Werkstätten gefördert. Während die Wirtschaftsware weiterhin von Hand geformt wurde, entstanden so Schalen, Becher und Flaschen.
Mit der Gründung der griechischen Kolonie Massalia an der Rhonemündung und dem Vordringen der Etrusker in die Poebene - beide Vorgänge waren Ausdruck mediterraner Auseinandersetzungen, bei denen auch Karthago und die Entstehung neuer Großreiche im Nahen Osten eine wichtige Rolle spielten - wurde ein Druck erzeugt, der die Beziehungen mit den nördlich der Alpen gelegenen Gebieten verstärkte. Südimporte belegen intensivierte Kontakte ab dem 7. Jahrhundert. Möglicherweise kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen und so wurden die auftauchenden Luxusobjekte vielleicht anfangs als loyalitätssichernde Prestigegüter verschenkt. Zu diesen gehört das goldene Collier aus einem Grabhügel in Ins ebenso, wie der goldene Anhänger aus Jegenstorf und die Hydria aus dem Wagengrab von Meikirch-Grächwil.
Als Umschlag- und Marktplätze dürften Höhensiedlungen nicht nur die umliegenden Regionen versorgt, sondern auch Anschluss an überregionale Handelsrouten gesucht haben. In der Höhensiedlung von Châtillon-sur-Glâne sind Tongefäße aus Massalia ebenso wie attische Keramik aus Griechenland fassbar. Das gleiche gilt für den Üetliberg bei Zürich und Baarburg bei Zug. Wein und Öl waren ebenso bedeutende mittelmeerische Produkte wie die Edelkoralle.
Bedingt durch diese Handelsverdichtung kam es ab Anfang des 6. Jahrhunderts entlang der Wasserwege und Passrouten zu Siedlungsgründungen. Dass die Golaseccagruppen eine Vermittlerrolle spielten, erweisen dort hergestellte Produkte, die in den alpinen Siedlungen und Gräberfeldern (Brig-Glis-Waldmatte, St. Niklaus, Chur-Welschdörfli, Tamins-Unterm Dorf) und auch nördlich der Alpen (Fehraltorf-Lochweid) entdeckt wurden. Kleiderteile oder Schmuck kamen wohl mit ihren Trägern in die Schweiz.
La Tène


Der ganz überwiegende Teil der Schweiz war während der Eisenzeit von Kelten besiedelt, deren Sprache den westlichsten Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie bildet, jedoch sind die Namen der beteiligten Stämme erst gegen Ende dieser Epoche überliefert. Diese sind die Helvetier, Allobroger, Rauriker, Lepontier, Uberer, Seduner, Veragrer und Nantuaten. Zu dieser Gruppe gehörten nicht die Räter, die in Graubünden lebten.53
Herodot berichtet, der Istros (die Donau) entspringe im Land der Kelten bei der Stadt Pyrene und fließe durch Europa. Griechische Quellen belegen keltische Verbände der Galater, die sich ab 279 v. Chr. in Kleinasien niederließen. Doch erst lateinische Autoren wie Caesar mit seinem Kommentar zum Gallischen Krieg (58-51 v. Chr.), aber auch Titus Livius, Tacitus oder Claudius Ptolemäus liefern eine Reihe von Berichten.
Das Gallische in Frankreich, Belgien, der Schweiz und der Poebene, das Keltiberische auf der kastilischen Hochebene und das Lepontische Norditaliens und des Tessins (in etruskischer Schrift) verschwanden nach der römischen Eroberung allmählich. Die wenigen Sprachmonumente sind dürftig, doch bringen Ortsnamen und archäologische Befunde weitere Klärung. Endungen von Ortsnamen auf -dunum, -dunon oder -durum weisen auf befestigte Siedlungen hin, wie im Falle von Eburodunum Yverdon-les-Bains, Salodurum Solothurn oder Vitudurum Winterthur.
Der früheste namentlich überlieferte Kelte ist ein Eluveitie („Ich gehöre dem Helvetier“). Er fand sich auf einem in Mantua entdeckten Gefäß in etruskischen Schriftzeichen. Dass die Helvetier im Gegensatz dazu die griechische Schrift benutzten, bezeugt Caesar. Während bis vor kurzem die Kelten noch mit den Trägern der Latènekultur gleichgesetzt wurden, geht die Tendenz dahin, kulturelle Aspekte stärker von den Interpretationen ethnischer Art zu trennen.
Herkunft
Vereinfachende Ausbreitungs- und Migrationsmodelle wurden vor dem Hintergrund seinerzeit gängiger rassischer Vorstellungen propagiert. Danach hatten die aus dem Osten gekommenen Kelten Westeuropa zur Eisenzeit erobert. Doch man ging weiter: Wenn die Latènekultur keltisch war, mussten es die Menschen der Hallstattzeit ebenfalls sein. Diese Vorstellungen gelten heute als zeitbedingt und überholt. Die Ausbreitung einer übergreifenden Sprache und das Bewusstsein, zu einer entsprechenden kulturellen Einheit zu gehören, geht wohl in die späte Bronzezeit zurück, vielleicht auch in die mittlere oder frühe Bronzezeit oder gar in die Jungsteinzeit, wie gelegentlich vermutet wird. So könnte die europaweite Verbreitung der Glockenbecherkultur über einem starken mitteleuropäischen Substrat mit der Ausbreitung der keltischen Sprachen zusammenhängen.
Das Gebiet der Schweiz zählte gegen Ende der Hallstattzeit zum Westhallstattkreis, dessen bekanntester Fundort die Heuneburg ist. Ein Teil der Wissenschaft geht davon aus, dass es sich bei diesen Bauwerken um „Fürstensitze“ (Châtillon-sur-Glâne, Uetliberg) und „Fürstengräber“ handelt. Dort fand man attische Keramik, Weinamphoren aus der Provence, Bronzegeschirr und Gefäße wie die „Vase“ aus Vix in Burgund oder die Hydria aus Grächwil. Sie belegen Beziehungen zur mediterranen Welt. Deren Prunkgegenstände kamen meist in befestigten Siedlungen entlang der Fernverbindungswege sowie in Hügelgräbern zutage. Die Hallstattgesellschaft erscheint demnach stark hierarchisiert. Diese „Fürsten“, die am Tauschhandel partizipierten, übten ihre Macht in einem abgegrenzten Territorium aus. Die Handwerker entwickelten die Eisenverarbeitung und führten bei der Keramikherstellung die Töpferscheibe ein. Über die Siedlungen ist hingegen sehr wenig bekannt.
Ursprung und Verbreitung (5. bis 3. Jahrhundert v. Chr.)
Die Entwicklung der Kunst, die nach eigenen Regeln mediterrane und auch orientalische Einflüsse integrierte, ist der deutlichste Beleg für eine eigenständige keltische Kultur. Ihr Repertoire zeugt nicht nur von vielgestaltigen Ausdrucksformen sondern verweist auch auf eine im Bereich des Religiösen verankerte Grundthematik. Doch die ersten Darstellungen von Gottheiten mit ihren Attributen bleiben namenlos, die Deutung der Figurenwelt selbst für den berühmten Fall der Goldringe von Erstfeld problematisch. Innerhalb dieser kulturellen Einheit lassen sich verschiedene Gruppen festmachen.
Nach den „Fürstengräbern“ der Champagne oder des Mittelrheins vom 5. Jahrhundert v. Chr. (Latène A) liefern Flachgräberfelder in ganz Europa die archäologischen Funde für die 2. Hälfte der älteren und den Beginn der mittleren Latènezeit (Latène B und C1, 4. und 3. Jahrhundert v. Chr.). Für diese Zeit ist die Schweiz dank der Gräberfelder von Münsingen-Rain, Saint-Sulpice in der Waadt, Vevey und Andelfingen für die Forschung zentral. Doch sind die ländlichen Siedlungen in der Schweiz noch kaum erforscht. Schmuckgegenstände aus Bronze sind mit höchster Feinheit ziseliert und verziert, ebenso Waffen und Helme mit reichen Einlassungen aus Gold und Korallen. Der Krieger spielte in der Gesellschaft eine überragende Rolle, einige als Heerführer angesprochene unter den Toten erhielten einen zweirädrigen Kampfwagen mit ins Grab. Doch der überwiegende Teil der Gräber lässt keine hierarchische Organisation erkennen, wie dies im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. der Fall war, wenn sich auch einige Männer durch das beigegebene Schwert und einige Frauen durch Reichtumsunterschiede anhand der nach genauen Regeln abgestuften Schmuckbeigaben unterscheiden lassen.
Dank technischer und stilistischer Besonderheiten einiger Schmuckgegenstände lässt sich die Gegenwart von Kelten aus dem Mittelland in Norditalien belegen. Beziehungen zwischen dem westlichen Mittelland und Böhmen sowie der Slowakei weisen auf Wanderbewegungen von Personen oder Personengruppen gegen Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. hin. Die mit Edelsteinen besetzten Scheibenhalsringe aus der nördlichen Schweiz und dem Oberrheingebiet könnten Ortswechsel, zumindest von Frauen, nach Ungarn um 300 v. Chr. andeuten. Folgt man Plinius dem Älteren, so soll der Helvetier Helico Feigen, getrocknete Trauben, Öl und Wein aus Italien mitgebracht haben, was dazu beitrug, dass seine Leute die Alpen überquerten. Das besagte Graffito Eluveitie („Ich gehöre dem Helvetier“) belegt tatsächlich die Anwesenheit eines Helvetiers in Mantua. Bekannt ist die Invasion zu Beginn des 4. Jahrhunderts, die in der Einnahme Roms um 390/386 v. Chr. durch Senonen gipfelte. Sie siedelten sich womöglich an der Adria an, doch Senonen finden sich zur Zeit Caesars auch um Sens. Ähnlich problematisch ist die Identifikation der in der Gallia Cisalpina erwähnten Völker der Lingonen, Boier, Cenomanen und Insubrer.
Nach Titus Livius, der die Ankunft der Kelten in Italien schon um 600 v. Chr. datiert, fand eine ostwärts gerichtete Wanderungsbewegung im 5. Jahrhundert statt, wie Funde in den Gräberfeldern der Slowakei oder Ungarns zu bestätigen scheinen. Von dort zogen einige Gruppen weiter nach Südosten, wo sie mit den hellenistischen Königreichen, die in der Nachfolge Alexanders des Großen standen, in Konflikt gerieten. Nach der katastrophalen Niederlage in der Schlacht bei Telamon in Etrurien 225 v. Chr. wurden die Kelten der Gallia Cisalpina nach und nach von Rom unterworfen. Ein Teil der Boier, die 191 v. Chr. gleichfalls unterlagen, überquerte die Alpen nordwärts.
Oppidakultur (2. und 1. Jahrhundert v. Chr.)
Nördlich der Alpen entstand die Oppidakultur. Die Kelten waren dem immer stärkeren Druck Roms ausgesetzt, aber auch demjenigen nördlicher, später germanisch genannter Stämme. Ab 125 v. Chr. eroberte Rom den Süden Galliens, gründete dort 118 Narbonne. Die Gallia Narbonensis umfasste das Rhonetal bis Genf, das Territorium der Allobroger.
Um 115 v. Chr. war die Wanderung der germanischen Kimbern und der Ambronen in Gang, die in Südböhmen, in der Slowakei und in Bayern belegt sind, dann in Noricum (in der Steiermark), wo sie eine römische Armee besiegten. Dann zogen sie mit anderen Völkern, die sich ihnen, wie die Teutonen und die helvetischen Tiguriner anschlossen, nach Gallien. Die Ambronen und die Teutonen unterlagen 102 bei Aquae Sextiae, dem heutigen Aix-en-Provence, die Kimbern 101 v. Chr. bei Vercellae im Piemont, heute Vercelli. In der Schlacht bei Agen 107 v. Chr. trat Divico als Führer der helvetischen Tiguriner hervor, die die Römer unter Lucius Cassius Longinus besiegten. Die wohl im Mittelland ansässigen Tiguriner zogen sich gerade noch rechtzeitig nach Norden zurück.
In der Spätlatènezeit (Latène C2 bis D) wurden die großen Nekropolen aufgegeben, Grabmäler wurden selten und eher spärlich ausgestattet. Zudem verbreitete sich ab der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. die Einäscherung im Mittelland, wenn sich auch das Verhältnis zwischen Erd- und Feuerbestattungen in den verschiedenen Gebieten unterschiedlich entwickelte: Im Gräberfeld von Basel-Gasfabrik sind nur Körperbestattungen nachgewiesen; im Mittelland kamen beide Bestattungsarten vor, wie z.B. in Bern-Enge oder Lausanne-Vidy. In den Alpen hielt sich die Körperbestattung bis in die römische Zeit.
Nun stammte der Hauptteil der Funde aus Siedlungen, vor allem aus den Oppida, die in der gesamten keltischen Welt entstanden - möglicherweise nach dem Vorbild mediterraner Städte. Die ersten keltischen Münzen sind dementsprechend Nachbildungen der Goldstatere König Philipps II. von Makedonien (359-336 v. Chr.). Silbermünzen nach dem Muster von Marseille wurden insbesondere in der Gallia Cisalpina geprägt.
Doch erst im Laufe des 2. Jahrhunderts setzte ein Geldumlauf ein, einige Oppida erlangten als Prägeorte größere Bedeutung. Als drei einflussreiche Völker Ostgalliens, die Lingonen, die Sequaner und die Haeduer, vielleicht auch die Helvetier, gegen Ende des 2. Jahrhunderts den Wert ihrer Münzen nach dem römischen Silberdenar ausrichteten, wirkte sich dies vor allem auf den Handel mit Rom aus. Die Oppida, meist Höhensiedlungen entlang der Handelsrouten in der Nähe von Rohstoffvorkommen, erlebten eine starke Entwicklung aller spezialisierten Tätigkeiten, sie fungierten als Märkte und infolge der herrscherlichen Wohnsitze auch als regionale Zentren von Verwaltung, Politik, Religion und Luxuskonsum. Caesar beschreibt die Gesellschaft als von einer Oligarchie beherrscht. Sklaverei war üblich. Bezeichnend ist die Episode des Helvetiers Orgetorix, der mit 10.000 Mann, all seinen Klienten und Schuldnern, 60 v. Chr. zu seinem Prozess erschien. Die Druiden spielten als Wahrer der ausschließlich mündlichen Überlieferung, des Wissens und der Erziehung, aber auch in religiösen und rechtlichen Belangen eine herausragende Rolle. Caesar vermerkte: „Nach ihrer Hauptlehre ist die Seele nicht sterblich, sondern geht von einem Körper nach dem Tod in einen anderen über. Auch meinen sie, diese Lehre sporne besonders zur Tapferkeit an, da man die Todesfurcht verliere.“54
Im Mittelland ist das zentrale Oppidum auf der Halbinsel von Bern-Enge bekannt; dasjenige auf dem Mont Vully wurde vielleicht von den Helvetiern bei ihrem Auswanderungsversuch 58 v. Chr. nach etwa einem Jahrhundert Nutzungszeit in Brand gesteckt.
Die nach Caesars Sieg gebauten Oppida sind von eher geringerer Ausdehnung. Einige, wie z.B. Bern, Yverdon-les-Bains, Genf (extremum oppidum allobrogum), Basel-Münsterhügel (Rauriker) oder Schanze und Oppidum auf Schwaben (Jestetten-Altenburg) waren bis in die Römerzeit bewohnt. Weitere Oppida sind Lindenhof in Zürich, Oppidum Eppenberg im Kanton Solothurn, Oppidum Uetliberg im Kanton Zürich, Aventicum (Kanton Waadt), das später die größte römische Stadt auf Schweizer Boden wurde, das Oppidum auf dem Mont Terri im Jura. 58 v. Chr. wurde der Vicus Petinesca gegründet und 14 bis 101 n. Chr. wurde Vindonissa von römischen Legionen genutzt. Die dörflichen Siedlungen - Caesars aedificia oder vici - sind in der Schweiz noch kaum von der Forschung zu fassen.
In der Schweiz gelten die Brücken von La Tène (3. und 2. Jahrhundert v. Chr.), das der Epoche den Namen gegeben hat, und von Cornaux-les-Sauges (um 100 v. Chr.) als bedeutende Heiligtümer, ebenso wie das 2006 entdeckte Heiligtum in Eclépens. Im Hafen von Genf sind die Überreste mehrerer Menschen mit zertrümmerten oder gespaltenen Schädeln entdeckt worden, was einige historische Berichte über Menschenopfer bestätigen könnte. Die eichenen Statuen von Genf, Villeneuve (VD) oder Yverdon-les-Bains stellen wohl Gottheiten dar. Einige Darstellungen können bestimmten keltischen Göttern zugeordnet werden, etwa dem Cernunnos, dem Gott mit dem Hirschgeweih (Balzers). Merkur, nach Caesar der meistverehrte Gott, wird gelegentlich mit Teutates gleichgesetzt; Belenus mit Apollon, Esus (der Krieger) mit Mars sowie Taranis (der Heilige) mit Jupiter.

Ab ca. 71 v. Chr. baute der Suebenkönig Ariovist ein Herrschaftsgebiet in Ostfrankreich auf. Diese Nachbarschaft war vielleicht ein Grund für den Auswanderungsversuch der Helvetier und der mit ihnen verbündeten Stämme im Frühling 58 v. Chr. Richtung Südwestfrankreich, den Caesar gewaltsam unterband. Unter Orgetorix, der während der Vorbereitungen starb, hatten die Helvetier begonnen, zwei Jahre lang Vorräte anzulegen, für das Vieh auf der Wanderung Vorsorge zu treffen und eine ausreichende Zahl von Karrren zu beschaffen. Darüber hinaus sorgte man für ein freundschaftliches Verhältnis zu den Stämmen, deren Gebiet man auf der Wanderung berühren würde. Doch die Römer lehnten den Durchzug ab, so dass die Helvetier gezwungen waren, eine nördlichere Route durch das obere Rhonetal zu wählen. Beim Abmarsch verbrannten sie das Getreide, das sie nicht brauchten, dazu ihre zwölf Städte, und 400 Dörfer, wie Caesar berichtet. Doch die angeblich 368.000 Helvetier trafen auf die pro-römischen Aedui und ihre 92.000 Waffenfähigen unterlagen schließlich den römischen Legionen. Die Überlebenden, nach Caesar etwa ein Drittel, mussten in ihr Gebiet zwischen Bodensee, Jura, Basel und Genf zurückkehren. Vieles spricht jedoch dafür, dass die „Auswanderung“ der Helvetier wohl eher als Kriegszug einzelner Stammesgruppen zu sehen ist, während die Siedlungen und Kultstätten der Helvetier eine ungebrochene Kontinuität zeigten. Dies sind zumindest Hinweise darauf, dass auch die Bevölkerungszahl nich so drastisch reduziert wurde, wie Caesars berichtet.
Die Romanisierung nach dem Gallischen Krieg erfolgte unterschiedlich intensiv und schnell. Die Gebiete der heutigen Westschweiz gerieten - wie auch diejenigen Frankreichs, Luxemburgs oder die Region um Trier - früh in diesen Sog. Das Mittelland und der Süden Deutschlands wurden dem Römerreich nach der Eroberung der Alpen und Rhätiens (16-15 v. Chr.) durch Tiberius und Drusus einverleibt, die Ostkelten einige Jahrzehnte später. Auf dem Land dürfte noch jahrhundertelang Keltisch gesprochen worden sein.
Etrusker und Räter

Im Tessiner Bezirk Lugano, genauer an einem Fundplatz in Bioggio, lässt sich die Anwesenheit von Etruskern belegen. Wichtig sind hier drei Stelen, die neben anthropomorphen Ritzungen Buchstaben des etruskischen Alphabets tragen. Sie geben – teils bruchstückhaft – Namen von Toten wieder, die jedoch nicht zuzuordnen sind.
Theodor Mommsen wies 1853 das Alphabet der Räter, die keine Kelten waren, den „nordetruskischen Alphabeten“ zu.55 Die Buchstaben ähneln tatsächlich denen der Alphabete der Etrusker und der Veneter, die wiederum von der westgriechischen Schrift abgeleitet sind. Nur die Alphabete von Bozen-Sanzeno und von Magrè in der Po-Ebene gelten heute als rätisch. Sie geben eine nicht indoeuropäische Sprache wieder, die dem Etruskischen eng verwandt, aber nicht selbst etruskisch ist. Dies kommt der Formulierung des Livius nahe, nach der die etruskische Abstammung der Räter am „Klang“ ihrer Sprache noch erkennbar war: „Auch die Alpenvölker haben unstreitig denselben Ursprung, vorzüglich die Räter, denen aber die Gegend selbst ihre Wildheit mittheilte und ihnen von allem Angeerbten nichts weiter übrig ließ, als den Klang der Sprache, und auch den nicht einmal unverfälscht.“56 Inschriften im Alphabet von Magrè wurden auch in der westlichen venetischen Ebene etwa bei Padua gefunden.
Die Räter in den mittleren Alpen wurden während der römischen Feldzüge im Jahr 15 v. Chr. weitgehend ausgelöscht, die Reste romanisiert. Die mit ihnen identifizierte Fritzens-Sanzeno-Kultur, eine archäologische Kulturgruppe der La-Tène-Zeit, wurde im späten 6. Jahrhundert v. Chr. erkennbar und löste in Südtirol und dem Trentino die späten Stufen der Laugen-Melaun-Kultur, in Nordtirol die bis dahin an der Urnenfelderkultur und dann an der Hallstattkultur der eher nördlichen Nachbarschaft orientierte Inntalkultur ab. Sie führte also die beiden voneinander unterscheidbaren Vorgängerkulturen zusammen.57 Die traditionelle Vorstellung einer Abstammung der heutigen Bevölkerung von den Rätern besteht heute nur in Graubünden. Offenbar wurde eine solche Tradition im Bereich der Raetia prima und dann von Churrätien gepflegt, wobei im früheren Mittelalter der Ausdruck ‚Raeti‘ für Bewohner dieses Gebiets verwendet wurde. Der Verlockung, sich auf die frühesten namentlich bekannten Völker als Ahnen zu berufen, war offenbar immer enorm groß. Auch an vielen anderen Stellen in Europa, und nicht nur dort, wurde so verfahren.
Geschichte der urgeschichtlichen Archäologie in der Schweiz




Erstmals wurde 1858 eine für die Urgeschichte bedeutsame Höhle entdeckt, nämlich die von Cotencher, Gemeinde Rochefort NE. Eine erste Grabung erfolgte jedoch erst 1867, nähere Untersuchungen während des ersten Weltkriegs in den Jahren 1916-1918.58 1874 begannen erste Untersuchungen im Kesslerloch, Gemeinde Thayngen im Kanton Schaffhausen,59 doch einen Ansatz zu einer Stratigraphie, die für die Datierung unerlässlich ist, boten nur die Grabungen von Jakob Heierli in den Jahre 1902 und 1903. Eine erste chronologische Einordnung der Funde gelang durch die Analyse der Faunenreste im selben Schichtzusammenhang. Ab 1953 führte die Sedimentanalyse zu differenzierten Ergebnissen, ab 1958 die Pollenanalyse. Paläolithische Freilandstationen sind in der Schweiz seltener, in jüngster Zeit waren tiefe Baugruben ertragreich. Dabei gelangen Funde vor allem im Baseler Raum, der nicht von Eismassen überfahren wurde. Es ist also kein Zufall, dass die beiden ältesten Faustkeile hier gefunden wurden.
Mittelpaläolithische Industrien lassen sich in Höhlen des Jura, der Alpen- und Voralpenzone, im Löß des Rheintals im Raum Basel und bei einer Silexlagerstätte im Jura fassen. Hier sind Wildenmannlisloch, Schnurenloch und Wildkirchli zu nennen. Das Ausgangsmaterial für die Werkzeuge der alpinen Höhlen war Quarzit in eher wenig geeigneter Form. Neben Cotencher ist die Kastelhöhle, Gemeinde Himmelried SO im Jura zu nennen. Dort sind, in der Schweiz selten, stratigrahische Abfolgen bis ins Jungpaläolithikum greifbar. Am besten untersucht ist unter den Freilandstationen Münchenstein. Höhlenhyäne, Wollhaarnashorn, Mammut, Ren, Pferd oder Murmeltier sind zusammen mit einer Abschlagindustrie belegt. An der Freilandstation Löwenburg, Neumühlefeld III bei Pleigne JU zerstörte jungpaläolithischer bergmännischer Abbau von Silex mittelpaläolithische Fundstätten, deren Artefakte immer wieder durch den Pflug zutage kamen. Nach formalen Kriterien ließen sich Verbindungen zum Moustérien des südlichen Rhonetals herstellen. Hier fand sich bester Silex.
Aurignacien und Gravettien fehlen in der Schweiz. Dies hängt mindestens partiell mit realen Zäsuren während der Phasen zusammen, als das Land unter einer Eisdecke lag. Erst das Magdalenien ist wieder häufiger vertreten. Neben Höhlen im Jura ist die Seeuferstation Hauterive-Champreveyres NE von Bedeutung. Hauterive liegt zeitlich vor dem Bölling-Interstadial, während Moosbühl, Gemeinde Moosseedorf BE wohl eher nahe dem Älteren Dryas einzuordnen ist, einer Phase nach der letzten Kaltzeit, die noch einmal enorme Kälte brachte.
Heute bestehen folgende Institutionen: das Seminar für Ur- und Frühgeschichte im Departement Altertumswissenschaften und Orientalistik, Philosophisch-Historische Fakultät sowie das Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie am Departement Umweltwissenschaften, Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, beide an der Universität Basel, eher für die Frühgeschichte das Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Römischen Provinzen an der Universität Bern und schließlich die Abteilung Ur- und Frühgeschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich.
Teil des Römerreichs
Ethnische Situation
Die ethnische Situation lässt sich vor Beginn der römischen Zeit relativ genau fassen und mit archäologischen Kulturen identifizieren. Dabei gehörten zum Kulturkreis der Golasecca-Kultur verschiedene Völker wie die Insubrer in der Gegend um Mailand oder die Orober zwischen Como und Bergamo sowie die Lepontier, die in den Zentralalpen an den Quellen des Rheins (Caesar, De bello gallico IV, 10) und der Rhone (Plinius der Ältere, Naturalis historia III, 24, 134 f.) sowie südlich bis in die Gegend nördlich von Como (Strabo, Buch IV) siedelten. Diese Gruppen spielten vom 7. bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. eine wichtige Rolle als Mittler im Verkehr zwischen den Etruskern im Süden und den nordalpinen Kelten. Daher finden sich in ihren Gräbern zahlreiche Artefakte aus dem Mittelmeerraum. Die Lepontier waren gleichfalls keltisiert, eine Eigenheit, die sie schon vor den Einfällen der Kelten nach Italien ab 388 v. Chr. aufwiesen. Erkennbar ist dies an latènezeitlichen Formen wie Fibeln oder durchbrochenen Gürtelhaken, aber auch an Helmen und Langschwertern aus Eisen. Sie leiteten aus dem etruskischen ein eigenes Alphabet ab, das Alphabet von Lugano. Mit der Expansion der Römer in die Po-Ebene im 2. Jahrhundert v. Chr. intensivierten sich die Kontakte.
Mit den Feldzügen unter Augustus zwischen 35 und 15 v. Chr., die auf Unterwerfung der Alpenvölker zur Sicherung der Handels- und Militärwege durch die Alpen abzielten, wurden die Lepontier ins römische Verwaltungs- und Wirtschaftssystem einbezogen und ein tiefgreifender Akkulturationsprozess setzte ein. Dennoch überlebten traditionelle Kulturelemente, etwa bei der Frauenbekleidung, der Keramik oder den Bestattungsriten, bis ins 2. und 3. Jahrhundert.
Eroberung, Romanisierung

Nachdem Rom seinen Feind Karthago, das von Hannibal geführt worden war, besiegt hatte, griff die Stadt am Tiber nach Norditalien aus. Das im Süden des Tessin gelegene Sottoceneri gehörte zum Siedlungsgebiet der Insubrer, deren Hauptort Mailand war. Rom unterwarf den gallischen Stamm Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. und ordnete ihn der Provinz Gallia Cisalpina zu. Das römische Bürgerrecht erhielten sie 49 v. Chr. und ihr Gebiet wurde Italia angegliedert (regio XI, Transpadana). 212 erhielten in der Constitutio Antoniniana alle Bürger des Reiches das römische Bürgerrecht, die bisherige Sonderstellung Italias verschwand damit.
Die Allobroger, deren nördlichstes Oppidum Genf war, wurden gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. gleichfalls unterworfen und ihr Gebiet der Gallia Narbonensis zugeordnet. Ihre Civitas wurde unter Caesar als Colonia Iulia Vienna neu gegründet, wobei der autochthone Adel seine Stellung bewahrte. Der von Vienne abhängige Vicus Genf stieg Ende des 3. Jahrhunderts zu einer Civitas auf und wurde im 4. Jahrhundert Sitz eines Bischofs.
Nach der Niederlage gegen Caesar in der Schlacht bei Bibracte im Jahr 58 v. Chr. wurden die Helvetier gezwungen, stark dezimiert, in ihre Ausgangsgebiete zurückzukehren. 57/56 v. Chr. versuchte ein Legat Caesars, Servius Sulpicius Galba, Walliser Gebiete entlang der Route über den Großen St. Bernhard zu erobern, doch scheiterte das Unternehmen trotz eines Sieges über die Veragrer.
45/44 v. Chr. errichtete Caesar südlich des Territoriums der Helvetier auf von diesen konfisziertem Gebiet eine Kolonie für ausgediente Reiter, die Colonia Iulia Equestris (Nyon), um den Kelten den Zugang zur Gallia Narbonensis zu verwehren. 44 v. Chr. gründete General Lucius Munatius Plancus - nach einem Sieg über die Rätier wohl am Ufer des Rheins - die Kolonie Raurica, die von Augustus neu organisiert wurde (Augusta Raurica, heute Augst).
Augustus ließ durch seine Adoptivsöhne Tiberius und Drusus die Alpen erobern. Der eigentliche Feldzug begann 15 v. Chr. mit einem Zangenangriff. Tiberius rückte von Lyon, Drusus durch das Etschtal heran. Weitere Truppen drangen in die Bündner Täler ein. Die Militäranlagen Basel-Münsterhügel und Zürich-Lindenhof sowie die drei Wachtürme am Walensee, nämlich Stralegg, Voremwald und Biberlikopf, sind Relikte dieses Kriegs. Die Lepontier und die Nantuaten, Veragrer, Seduner und Uberer des Wallis unterwarfen sich ebenfalls den Römern.
Zwischen dem 2. Jahrhundert und 13 v. Chr. wurde das Gebiet der Schweiz also Schritt für Schritt in das Römische Reich eingegliedert, zu dem es bis ins späte 5. und dann erneut im 6. Jahrhundert gehörte.60 Damit wurden Kelten und Räter in eine größere, mediterrane Welt und in eine vielfältige Kultur integriert. Es entstand die Kultur der Galloromanen.

Die Helvetier und die Rauracher sowie die beiden Kolonien Nyon und Augst wurden zunächst der Gallia Lugdunensis, später der kaiserlichen Provinz Gallia Belgica mit Verwaltungssitz in Trier zugewiesen. Die Bergregionen im Wallis, in der Leventina und Graubünden wurden in einer „Passprovinz“ vereint, die einem Statthalter aus dem Ritterstand anvertraut wurde.
Rom sicherte seine Eroberungen durch Legionsstandorte und durch die Einrichtung von Kolonien. Von Archäologen ergraben wurden etwa Nyon am Genfersee und Augst bei Basel, das die Römer Augusta Raurica nannten. Graubünden wurde erst unter Tiberius endgültig um 15 v. Chr. erobert. Dort entstand in Vindonissa im Kanton Aargau, genauer gesagt bei Windisch, ein Militärstützpunkt.
Hauptort Helvetiens wurde Aventicum oberhalb des Murtensees. Diese Siedlung wurde 71 n. Chr., nachdem zwei Jahre zuvor ein Aufstand niedergeschlagen worden war, zur Kolonie erhoben. Nach den Inschriften zu urteilen war sie jedoch weiterhin hauptsächlich von Einheimischen bewohnt. Genf wurde Hauptstadt der Provinz Gallia Narbonensis, das südliche Tessin gehörte zu Italia, das Mittelland bis zum Jahr 89 zu Gallia Belgica, dann zu Germania superior. Die östliche Schweiz gehörte schließlich zu Raetia, während das Wallis mit dem oberen Isère-Gebiet die Provinz Alpes Graiae et Poeninae bildete.

Rom trieb zum einen die Urbanisierung voran. Städte wie Aventicum, Nyon, Martigny oder Augst erhielten römische Bauten, wie die meisten Städte des Riesenreichs. Dazu gehörten Tempel, Amphitheater oder Thermen, aber auch innerörtliche Straßenpflasterungen. Zudem entstanden Marktorte (vici). Die Herren auf dem Lande errichteten ausgedehnte Gutshöfe mit Herrenhäusern, die villae. Verwalter führten diese Agrarbetriebe, Gesinde versah die eigentlichen Arbeiten, ebenso wie Sklaven, die eigene, abgetrennte Wohnstätten erhielten. Es entstand ein Netz von Überlandstraßen, wie etwa die Straße von Italien über den Großen Sankt Bernhard an den Genfersee. Von dort ging es weiter nach Gallien.
Die Anlage der vici im Nordosten, in Oberwinterthur und Zürich-Lindenhof, dürfte militärischen Interessen gedient haben, ebenso wie der Straßenbau. Fünf Jahre nachdem Varus 9 n. Chr. im Teutoburger Wald besiegt worden war, errichteten die Römer das Legionslager Vindonissa (heute Windisch). Dieser Umstand führte wohl zu einer Neuordnung des Gebiets der Helvetier, deren Civitas wiederhergestellt wurde.
Kaiser Claudius (41-54) führte die Organisation der Verwaltung zu Ende. Nachdem der Transit über den Großen St. Bernhard neu organisiert worden war, gründete er in Octodurus (heute Martigny) das Forum Claudii Vallensium und fasste die vier Civitates des Wallis zu einer einzigen - der Civitas Vallensium - zusammen. Diese erhielt das latinische Bürgerrecht, das es ermöglichte, durch Ausübung eines Amts das römische Bürgerrecht zu erwerben. Das Wallis wurde von der Provinz Raetia abgetrennt und wohl mit der Tarentaise zur Provinz Alpes Graiae et Poeninae vereinigt.
Berichte über die Mitwirkung der Helvetier in den Hilfstruppen und kaiserlichen Garden zeugen von ihrer Eingliederung in die Armee. Sie nahmen als Anhänger von Kaiser Galba im Jahr 69 an den Bürgerkriegen teil, was zu Zusammenstößen mit Truppen seines Gegners Vitellius führte. Die Helvetier setzten jedoch auf den falschen Prätendenten. Sie wurden bei Bözberg besiegt und ihre Hauptstadt beinahe zerstört. Doch aus dem Bürgerkrieg ging weder der eine noch der andere Kaiser als Sieger hervor, sondern Vespasian, dessen Sohn Titus einen Teil seiner Jugend in Avenches verbracht hatte, und der Jerusalem zerstören ließ. Er erhob die Civitas Helvetiorum in den Rang einer latinischen Kolonie, wodurch er die dortigen Führungsgruppen stärkte. Die sozial niedriger gestellten Helvetier lebten wie gewohnt, was die Aufstellung der Cohors I Helvetiorum, einer Hilfstruppeneinheit, vor der Mitte des 2. Jahrhunderts belegt.
Im Jahr 72 verschob der Kaiser die Grenze nach der Eroberung des Dekumatenlandes weiter nach Norden, um 85 trennte Kaiser Domitian die Militärbezirke von der Gallia Belgica ab, um die beiden germanischen Provinzen zu bilden. Die Helvetier, Rauriker und die beiden Kolonien kamen zur Germania Superior. 101 wurde das Legionslager Vindonissa aufgelöst, ein Anzeichen, dass das Gebiet nicht mehr als Frontgebiet betrachtet wurde.
Trotz der schwierigen Transportwege nahm der Fernhandel im 2. Jahrhundert einen enormen Aufschwung. Einige Herrenhäuser von römischen Gutshöfen wurden mit Mosaiken und Wandfresken ausgeschmückt und mit Badezimmern und heizbaren Räumen ausgestattet, so in Orbe-Boscéaz, Pully und Colombier im Kanton Neuenburg.
Der Kampf des Septimius Severus um die kaiserliche Macht brachte in der Schlacht bei Lyon (197) eine erste Unruhephase, 213 wurde erstmals über einen Alamanneneinfall in der Mainregion berichtet. Diese fielen bald wieder in die germanischen Provinzen und in Rätien ein. Gallienus ließ Vindonissa befestigen und besiegte Alamannen und Iuthungen in der Nähe von Mailand. Die Kolonien Augst und Avenches wurden wohl in den Jahren 275 bis 277 geplündert und teilweise zerstört. Der obergermanisch-rätische Limes wurde aufgegeben, so dass erneut der Rhein die Reichsgrenze bildete.
Diokletian (284-305) reformierte das Verwaltungssystem. Er gründete vier Präfekturen, die in Diözesen unterteilt waren. Letztere wiederum zerfielen in eine erheblich vergrößerte Anzahl sehr viel kleinerer Provinzen. Die Grenze zwischen den Präfekturen Gallia und Italia verlief dabei durch das Gebiet der Schweiz. Diokletian und Konstantin (306-337) befestigten auch die Reichsgrenze durch den Bau von Kastellen wie Vitudurum (Oberwintherthur), Tasgaetium (Burg, Gemeine Stein am Rhein) und insbesondere die große Anlage des Castrum Rauracense (Kaiseraugst), in der die Legio I Martia stationiert war. Entlang der Hauptverkehrsachsen errichtete Festungen vervollständigten das Verteidigungssystem. Die Alamannen schlug Constantius Chlorus 302 in einer Schlacht bei Vindonissa.
Nach einem halben Jahrhundert des Friedens setzten sie 352, von Constantius II. im Kampf gegen den Usurpator Magnentius zum Einfall aufgefordert, das Castrum Rauracense in Brand (damals wurde der Schatz von Kaiseraugst vergraben). 357 besiegte Julian Apostata die Alamannen bei Straßburg. Julian und später Valentinian I. (364-375) befestigten den Limes mittels Wachttürmen (burgi).

Doch die Grenzbefestigungen erwiesen sich angesichts des wachsenden Druckes, den Germanen und Hunnen ausübten, als immer weniger geeignet, das Reich zu schützen. Der Heermeister Stilicho, der Italien gegen Alarichs Westgoten verteidigte, zog 400 die Truppen von der Rheingrenze ab. Zur Reichsverteidigung siedelte Aëtius, der gallische Heermeister unter Valentinian III. (425-455), die Burgunder 443 in Savoyen und in der Westschweiz an (Sapaudia).
Nachdem die nördlich der Alpen gelegenen Teile des Reichs sich selbst überlassen worden waren, wanderten Alamannen und einige Franken im 6. Jahrhundert nach und nach ins Schweizer Gebiet ein. Erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts trennten sich, nachdem es Ostrom noch einmal gelungen war, Italien zurückzuerobern, die nördlichen Provinzen endgültig vom Reich.
Christianisierung, Ende der Römerherrschaft
Zahlreiche religiöse Strömungen fanden bis ins 4. Jahrhundert Verbreitung. 312 erkannte Kaiser Konstantin I. das Christentum an und Theodosius I. (379-395) erhob es zur Staatsreligion. Pagane Kulte sahen sich zunehmend Benachteiligungen ausgesetzt. Wie Funde in der sogenannten Kulthöhle Zillis in Graubünden erwiesen, bestanden sie im Verborgenen weiter. Die Höhle diente als Begräbnis- und Kultstätte, die hauptsächlich von 260 bis 500 benützt wurde. Welche Gottheit verehrt wurde, ist jedoch unklar. Das Schlangenmotiv, der Ort der Höhle und die Bedeutung des Feuers weisen möglicherweise auf einen Mithraskult hin. Christen bereiteten dem Kult ein Ende, indem sie die Höhle im 6. Jahrhundert mit Erde auffüllten. Dazu passt, dass das Kultgefäß stark zerstört außerhalb der Höhle gefunden wurde. Der gepfählte Tote, wenn das stark beschädigte Rückgrat richtig gedeutet wurde, könnte ein Priester gewesen sein, der von Christen hingerichtet wurde. Darüber hinaus stimmen die Funde aus dem späten 8. und frühen 9. Jahrhundert damit überein, dass Bischof Remedius von Chur noch um 800 heidnische Kulte untersagte.60x
Teilen der einheimischen Eliten gelang der Zugang zu den führenden Gesellschaftsschichten, denn die Durchgangsprovinzen boten Möglichkeiten zu Ansehen, Vermögen und politischer Macht zu gelangen. Während das Territorium der Civitas der Helvetier bereits als Drehscheibe für den Straßen- und Flussverkehr diente, war es nun der Große St. Bernhard und nicht der Gotthard, der die beste Verbindung vom Rhein nach Rom gewährleistete. Die unbewohnten Regionen andererseits nahmen wachsende Flächen in Anspruch. So waren die Talböden der großen Flüsse und Seen sumpfig, und ganze Regionen, wie Appenzell, St. Gallen, Glarus oder Teile der Innerschweiz waren dicht bewaldet.
Dabei war der Bruch zur neu entstehenden Kultur und Gesellschaft zwar scharf, doch gab es auch Kontinuitäten. Die ältesten Bistümer und die einzigen seit der Antike fortbestehenden sind die von Genf und Chur. Ansonsten ist aus der Spätantike wenig bekannt, zumal seit den hochgradig ideologischen Diskussionen um die „Germanenmission“ im 19. und durch den Missbrauch des Themas durch die Nationalsozialisten kaum noch an dem Thema geforscht wurde.
Bischof Eucherius von Lyon († um 450) berichtet in seiner Passio Agaunensium martyrum von der Thebaischen Legion, die um 300 in St. Maurice im Wallis stationiert war. Sie stammte aus Ägypten und alle 6.600 (anonyme Fassung: 6.660) Mitglieder waren demnach Christen. Sie wurde angeblich von Mauritius geführt, der (nach späterer Überlieferung) auch im Besitz der Heiligen Lanze gewesen sein soll. Nur wenige der Soldaten, die sich weigerten, dem Kaiser ein Opfer zu bringen oder Christen zu verfolgen, entkamen. Felix und Regula, die im Siegel des Kantons Zürich auftauchen, flohen ins damals noch Turicum genannte Zürich, Ursus und Victor nach Solothurn. 515 gründete Sigismund, designierter König der Burgunder, die nach dem Heiligen Mauritius benannte Abtei Saint-Maurice.
Im 13. Jahrhundert wurde erstmals von einem Mönch namens Beatus berichtet, der in die Region des Thuner Sees lebte und dort um 100 gestorben sein soll. Seine Wohnstätte in der Höhle am Thuner See (St. Beatus-Höhlen) wurde zu einem Pilgerort. Mit dieser und ähnlichen Legenden bemühte man sich darum, eine ununterbrochene Tradition seit der apostolischen Zeit zu erweisen.
Die ältesten Kultbauten fand man dementsprechend in Saint-Maurice im Wallis, in Genf und Chur. Allerdings waren zu dieser Zeit, dem 4. Jahrhundert, die Städte seit langem im Niedergang begriffen. Bereits um 260 hatten Alamannen das Mittelland geplündert, während die Juthungen erst auf dem Rückweg bei Augsburg besiegt werden konnten. Hundert Jahre später beschreibt Ammianus Marcellinus die Stadt Aventicum als verfallen.61 Dennoch deckten weiterhin Castra die Rheingrenze und auch im Hinterland waren sie verstreut. Die romanisierte Bevölkerung zog sich nach Abzug der Legionen in die befestigten Städte zurück, dann zunehmend ins Rhonegebiet und ins nördliche Graubünden. Die Villae wurden zu drei Vierteln aufgegeben. Zurück blieb eine isolierte ländliche Bevölkerung, die sich der Plünderzüge zu erwehren suchte.
Burgunder und Alamannen
Burgunderreich (um 443-534)
Niederlage und Flucht, Bund mit Gallorömern, Kaisermacher (bis 476)

Die weitgehend leeren Siedlungskammern wurden zunächst von Burgundern im 5. Jahrhundert besiedelt.61k Diese Burgundiones werden erstmals von Plinius dem Älteren († 79) erwähnt, der in ihnen einen der fünf Teile der Vandili sieht ((Nat. Hist. IV, 28)), die üblicherweise mit den Vandalen gleichgesetzt werden. Ptolemaios nennt sie in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts als östliche Nachbarn der Semnonen und siedelt sie zwischen der mittleren Oder und der Weichsel an. Ammianus Marcellinus hingegen behauptet, sie seien römischen Ursprungs, seien also aus Resten unterworfener germanischer Gruppen und den Besatzungen der Grenzkastelle am Limes hervorgegangen. In den 270er Jahren kamen einige von ihnen erstmals mit den Römern in Berührung, eine größere Gruppe von ihnen nahm das Rhein-Main-Gebiet ein, als die Alamannen südwärts drängten. Sie suchten das Bündnis mit Rom, ein gemeinsamer Feldzug gegen die Alamannen scheiterte 369/370, weil die Römer in der unerwartet hohen Zahl von Kriegern eine Bedrohung sahen (Amm. XXVIII,5,11-13; XXX,7,11). Ende des 4. Jahrhunderts verdrängten die Burgunder, nach 370 wohl zum Arianismus bekehrt, die Alamannen aus dem Raum zwischen Taunus und Neckar und erreichten den Rhein, den der überwiegende Teil von ihnen an der Jahreswende 406/407 im Gefolge des Vandalen-, Sueben- und Alaneneinfalls gleichfalls überschritt. Als foederati, zu Hilfeleistung verpflichtete Siedler, wurden sie mit der Sicherung der Rheingrenze betraut, doch unterstützten sie 411 unter Gundahar die Erhebung des Jovinus in der Provinz Germania Secunda, begleiteten ihn nach Südgallien und erhielten nach seinem Tod im Jahr 413 als Föderaten ein Gebiet nahe dem Rhein, wahrscheinlich am Mittelrhein. Zwar besiegten sie 430 eine hunnische Abteilung, doch gerieten sie in die Machtsphäre der Hunnen, von denen sie die Sitte der Schädeldeformation übernahmen.
Doch diese erste Reichsbildung ging 436 im Kampf mit Römern und Hunnen unter. Als sie 435 in die Provinz Belgica I eindrangen, wurden sie vom römischen Feldherrn Flavius Aëtius besiegt, dann von Hunnen beinahe aufgerieben. Die Überlebenden zogen nach römischem Willen in die Sapaudia, eine aus den Quellen kaum zu erschließende räunmliche Einheit, zu der wohl Genf und Yverdon zu rechnen sind. Die Burgunder siedelten also wohl nordwestlich des Genfer Sees am Neuenburger See.62 Dort stellten sie jedoch nur ein Zehntel der Bevölkerung. Daher verschwand ihre Sprache schnell, von ihrer Kultur blieb nur wenig übrig. Sie wurden wohl an den Steuereinnahmen der Städte beteiligt, wurden also nicht wie sonst üblich angesiedelt, indem sie Anspruch auf ein Drittel des Besitzes der Galloromanen erhielten. Dieser Steueranteil floss bis dahin nach Rom, was ihre spätere Ausbreitung erleichterte, denn die Provinzialen wurden dadurch nicht stärker belastet. Zugleich blieb die Hälfte der Waldflächen im Besitz dieser Romanen, die Burgunderkönige erlaubten sogar das conubium, die Ehe zwischen Burgundern und Provinzialrömern. Ausschließlich die Burgunder waren zunächst für den militärischen Schutz verantwortlich.
So entstand eine übergreifende Führungsschicht, die ihren Einflussbereich bis weit in den Süden, bis in die Provence ausdehnen konnte. Die Römer unter Flavius Aëtius planten sie wohl für den Schutz der Alpenpässe und der Rhein-Rhone-Verbindung und als zusätzliche Eingreifreserve ein. Tatsächlich kämpften sie 451 auf römischer Seite gegen die Hunnen auf den Katalaunischen Feldern. 456 unterstützten sie unter ihren Königen Gundowech und Chilperich - damit ist auch wieder ein burgundisches Königtum belegt - den römischen Kaiser Avitus gegen die Sueben auf der Iberischen Halbinsel. Avitus wurde jedoch 457 von seinem eigenen Heermeister Flavius Ricimer gestürzt, der die weströmische Politik bis 472 beherrschte.
457 dehnten die Burgunder wohl im Einverständnis mit den Galloromanen, deren Kaiser ja gestürzt worden war, ihr Herrschaftsgebiet in den Rhone-Saône-Raum aus und besetzten Lyon. Von dort wurden sie 458 zwar von Aegidius wieder vertrieben, doch 461 besetzten sie die Stadt endgültig. Valence gehörte spätestens 463 zum Herrschaftsgebiet des Burgunderkönigs Gundowech, der sogar in einem Brief von Papst Hilarius an Caesarius von Arles als magister militum Galliarum erscheint und der seinen Sohn Gundobad zum Heermeister Ricimer nach Rom schickte. Die Burgunder sahen sich auch im Kampf gegen die Westgoten immer noch als Teil des Römerreiches; als Ricimer 472 ermordet wurde, trat Gundobad im Westen seine Nachfolge an und beförderte Glycerius zum Kaiser. Als jedoch der oströmische Kaiser den weströmischen Kaiser Glycerius vertreiben ließ, musste auch Gundobad Rom verlassen. Die Westgoten nutzten die Gelegenheit des Sturzes des letzten römischen Kaisers, um die Provence zu besetzen. 478 wurde die Südgrenze des Burgunderreichs an der Durance durch einen Vertrag mit den Westgoten festgelegt, den Burgundern blieb der Zugang zum Mittelmeer versperrt. Im Norden verdrängte Chilperich die Alamannen aus Langres und Besançon. Als der Frankenkönig 486 den letzten römischen Statthalter Syagrius besiegte, wurden sie zu unmittelbaren Nachbarn der Burgunder und der Westgoten.
Reichsteilung, zwischen den germanischen Großmächten (um 473-516)
König Gundiochs vier Söhne teilten das Reich auf. Gundobad wurde eine Art Oberkönig mit Sitz in Lyon, Godegisel, Chilperich II. und Godomar wurden Unterkönige mit Sitzen in Genf und womöglich in Valence und Vienne. Die beiden letzteren scheinen bald verstorben zu sein. Durch ein doppeltes Ehebündnis - Gundobads Sohn Sigismund heiratete 492/494 Ariagne, die Tochter des Ostgotenkönigs Theoderich, Chrodechild, die Tochter Chilperichs II., ehelichte 492/493 den Frankenkönig Chlodwig I. - versuchte Gundobad, sich gegen die beiden mächtigsten Nachbarn abzusichern. Noch kurz zuvor hatte er die Kämpfe zwischen Theoderich und Odoaker ausgenutzt, um in Ligurien einzufallen und 6.000 Gefangene zu machen.63 Diese sollten 495 durch Bischof Epiphanius von Pavia freigekauft werden.
Doch im Jahr 500 kam es zum Streit zwischen Lyon und Genf, zwischen den beiden burgundischen Brüdern. Dabei griffen die Franken gegen Tributzusagen zugunsten von Genf ein, die Westgoten, die im Ehesystem nicht direkt vorgesehen waren, hingegen zugunsten Gundobads. Gundobad, der bei Dijon im Jahr 500 unterlag, konnte mit westgotischer Hilfe sein Reich zurückerobern - sein Bruder und dessen Familie wurden nach der Eroberung Viennes getötet (501). Doch dann wechselte er die Seite und verbündete sich mit dem Frankenkönig Chlodwig gegen die von den Ostgoten geschützten Alamannen, von denen viele nach Italien flohen, und gegen die Westgoten.
Letztere unterlagen 507/08 gegen Chlodwig. Gundobad nutzte die Gelegenheit und zog gegen Narbonne, Arles, Avignon und Marseille, das ihnen nun aber die Ostgoten Theoderichs wieder entrissen. Die Provence wurde eine gallische Präfektur der Ostgoten, Theoderich zog bis nach Embrun. Gundobad gelang, sieht man von Viviers ab, keinerlei Gebietsgewinn zwischen den mächtigen Nachbarn. Doch durch den Tod des Frankenkönigs Chlodwig beruhigte sich die Lage an der Nord- und Westgrenze zunächst.
Katholisierung, Anlehnung an Ostrom, Feindschaft mit Ostgoten, Eroberung durch Franken (bis 534)
Das Ende seines Reiches erlebte Gundobad nicht mehr. Er starb 516. Ihm folgte sein ältester Sohn Sigismund, der Rückhalt im fernen Konstantinopel suchte. Sigismund war zwischen 501/502 und 507 vom Arianismus zum Katholizismus konvertiert, was die Spannungen mit den weiterhin arianischen Ostgoten verstärkte, die eine Gesandtschaft zum Kaier abfangen ließen. Andererseits folgte er damit den Franken, deren Könige sich seit einiger Zeit zum Katholizismus bekannten.


Die Feindschaft mit den Ostgoten erklärt, warum Sigismund 522 seinen Sohn Sigerich, den Enkel des Ostgotenkönigs Theoderich, ermordete, denn er verdächtigte ihn des Komplotts mit dem ostgotischen Arianer. Die Franken nahmen dies zum Anlass, in Burgund einzufallen und den Norden des Reichs zu besetzen. Theoderich seinerseits okkupierte 523 das Gebiet zwischen Durance und Isère. König Sigismund, der in das von ihm 515 gegründete Kloster Saint-Maurice im Wallis geflohen war, wurde ausgeliefert und von König Chlodomer mitsamt seiner Frau und seinen Kindern getötet.
Sigismund hatte eine Gesetzessammlung, den Liber Constitutionum initiiert. Er war zwar katholisch, geriet jedoch aufgrund einer Personalie in Konflikt mit Rom. Dabei hatte der Papst einem seiner Beamten (?) vorgeworfen, Inzest zu begehen, da er die Schwester seiner verstorbenen Frau geheiratet hatte. Sigismund wollte ihn jedoch nicht fallenlassen.
Godomar gelang es am 25. Juni 524 in der Schlacht bei Vézeronce (östlich von Vienne), noch einmal, die fränkische Expansion zu stoppen - dabei kam Chlodomer ums Leben -, doch unterlag er 532 den Franken endgültig bei Autun. Anscheinend hatte er nach dem Tod Theoderichs mit dessen Tochter Amalasuntha noch vertraglich die Rückgabe südgallischer Gebiete ausgehandelt.
534 teilten die fränkischen Merowinger das Burgunderreich auf, nachdem Godomar, dessen weiteres Schicksal unbekannt ist, endgültig unterlegen war. Theudebert I., der Reimser König, erhielt Nordburgund mit Langres, Besançon, Autun und Chalon-sur-Saône sowie Aventicum-Vindonissa und Octodurus auf dem Gebiet der Schweiz. Childebert I., der seinen Sitz in Paris hatte, erhielt den Kernraum mit Lyon, Mâcon, Vienne, Grenoble, vielleicht auch Genf und Tarentaise. Der dritte König, Chlothar von Soissons, erhielt wohl den Süden bis zur Durance.
Ausgehend von den Gräberfeldern schätzte man die Gesamtzahl der Bewohner des Königreichs Burgund auf 300 bis 500.000 Personen, wovon vielleicht 80 bis 100.000 in der Westschweiz lebten. Folgt man den Angabem der Lex Burgundionum von 517, so standen den Burgundern zwei Drittel des Ackerlandes, ein Drittel der Sklaven sowie die Hälfte von Haus, Hof, Garten, Wald und Weide zu. Vergleichsweise sichere Anzeichen für die Anwesenheit von Burgundern in der Sapaudia und um Genf sind frühe germanische Vogelkopf- und Bügelfibeln, Eisenhalsringe, dann Körbchenohrringe und Metallspiegel östlicher Herkunft, schließlich die besagten deformierten Schädel, die wohl auf hunnischen Einfluss zurückgehen. Hinzu kommen Inschriften mit burgundischen Namen. In die Gräberfelder von Sézegnin und Monnet-la-Ville teilten sich Burgunder und Romanen. In Nordburgund spricht man von einer einheitlichen Trachtprovinz, da die Kleidung wohl überwiegend aus romanischen Werkstätten stammte. Vielleicht ist die Verbreitung der -ingos-Namen bis zur Saane und in den Berner Südwestjura als Anzeichen für ein gewisses Nachleben der burgundischen Sprache zu werten.64
Alamannen

Archäologisch ist die alamannische Expansionen kaum fassbar. In Sachkultur und Bestattungssitten lassen sich innerhalb der Reihengräberkultur etwa zu den Franken nur fließende Übergänge, kaum aber deutliche Kulturgrenzen ausmachen. Aussagen sind im Wesentlichen aus Schriftquellen erschlossen. 289 wird erstmals der Stamm der Alamanni, 297 ihr Gebiet (Alamannia) in zeitgenössischen Quellen erwähnt. Der Name bedeutet soviel wie „Menschen/Männer insgesamt, allgemein“. Dabei standen vom ausgehenden 3. Jahrhundert an viele Alamannen in römischen Diensten, etwa als Soldaten. Sie erscheinen auch als Geiseln und als in geschlossenen Verbänden unter eigener Führung angesiedelte Wehrbauern.
Die Besiedlung durch alamannische Bevölkerungsgruppen oder auch nur zeitweise alamannische Oberherrschaft erfolgte in einem beträchtlichen Gebiet Es reicht nördlich bis in die Gegend um Mainz und Würzburg, südlich bis zu den Voralpen, östlich bis zum Lech bzw. entlang der Donau bis fast nach Regensburg, westlich bis an den Ostrand der Vogesen, jenseits der Burgundischen Pforte bis um Dijon sowie südwestlich im Schweizer Mittelland bis an die Aare.
Ein Konflikt mit den benachbarten Franken führte nach Gregor von Tours irgendwann zwischen 496 und 507 zu entscheidenden Niederlagen der Alamannen gegen den fränkischen König Chlodwig I. Die Entscheidungsschlachten waren möglicherweise die Schlacht von Zülpich (496) sowie die Schlacht bei Straßburg (506). Der Ostgotenkönig Theoderich bremste die fränkische Expansion, indem er die südlichen Teile Alamanniens und die Flüchtlinge unter seinen Schutz stellte. Spätestens 506 scheint sich die alamannische Führungsschicht unter ostgotischen Schutz begeben zu haben. Teile der Alamannen wurden in Oberitalien und offenbar im rätischen Gebiet des Bodenseeraumes, des Thurgaus und des Alpenrheintals angesiedelt.
Teil des Frankenreichs
Doch schon 536/537 überließ der von oströmischen Truppen bedrängte Ostgotenkönig Witigis dem Frankenkönig Theudebert I. unter anderem Churrätien und das Protektorat über „die Alamannen und andere benachbarte Stämme“, um sich die Unterstützung der Merowinger zu erkaufen. Infolgedessen befanden sich alle Alamannen unter fränkischer Herrschaft.
Die Franken setzten nun unregelmäßig Herzöge für das alamannische Gebiet ein. Man geht davon aus, dass fränkische Adlige an strategisch wichtigen Orten angesiedelt wurden, um die Kontrolle über das Land zu sichern. Das bestätigt sich in Grabfunden mit fremden Schmuck- und Waffenformen, die aus dem westfränkischen Raum oder dem Rheinland stammen. Auch Angehörige anderer Völker des Frankenreichs wurden im alamannischen Gebiet angesiedelt, was sich in Ortsnamen wie Türkheim (Thüringer), Sachsenheim oder Frankenthal niederschlug. Erst nach Einbeziehung ins Frankenreich wurde eine weitere Besiedlung der südlich angrenzenden romanischen Gebiete möglich. Nach den Erkenntnissen der archäologischen Forschung65 hat die alamannische Siedlungstätigkeit in der heutigen Deutschschweiz nicht vor Ende des 6. Jahrhunderts eingesetzt.
Die Alamannen, ein Zusammenschluss verschiedener Stämme zu Eroberungs- und Plünderungszwecken, unterlagen gleichfalls den Franken. Sie zogen sich daraufhin in die Gebiete südlich des Rheins zurück. Hier, wo die romanisierte Bevölkerung weniger zahlreich und kulturprägend war, setzte sich die Sprache der Neuankömmlinge durch. Die Romanen assimilierten sich den Alamannen bis in das 7. Jahrhundert. Allerdings fluktuierte die Sprachgrenze, so dass im Waadtland eine Mischung beider Sprachen bestand. Im Laufe des 8. und 9. Jahrhunderts stabilisierten sich die Sprachgrenzen, wenn auch weiterhin Übergangsräume bestanden.
Merowinger und alamannische Herzöge (ab 506)
536/537 traten die Ostgoten den Franken neben der Provence die Herrschaft über Alamannien ab, also über die bis dahin unter ostgotischem Schutz stehenden Alamannen der Raetia Prima sowie über Churrätien selbst. Als der Merwinger Theudebert 539 in den gotischisch-oströmischen Krieg in Italien eingriff, standen bald die Passlandschaften von den Westalpen bis nach Pannonien sowie das Alpenvorland, d.h. Burgund, Alemannien, Bayern und die Alpenromanen Rätiens und Noricums unter fränkischer Herrschaft.
Bis Mitte des 7. Jahrhunderts blieben die Alamannen den fränkischen Merowingern unterstellt. Zwar lösten sie sich zunehmend aus deren Machtbereich, doch die Karolinger, die als Hausmeier die eigentliche Macht im Frankenreich längst übernommen hatten, integrieten sie um 740 wieder stärker in ihr Reich. Die Franken sicherten sich damit den Zugang nach Italien, das vor allem Pippin und Karl über die Graubündener Pässe aufsuchten. Karl zog Ende 773 mit zwei fränkischen Heeresaufgeboten von Genf aus nach Italien. Eines führte er selbst über den Mont Cenis, das andere führte sein Onkel Bernhard über den Großen St. Bernhard.65f Karl eroberte das Langobardenreich und ließ sich 800 in Rom zum Kaiser krönen. Genau um diese Pässe ging es auch in den Erbteilungen der Nachfolger Karls und seines Sohnes Ludwig, genannt der Fromme. Das Wallis und der Genfersee gingen dabei an Westfranken, der Rest an Ostfranken. Der Gotthard bildete die Grenze nach Italien. So dominierte niemand alle Pässe gleichzeitig. Zu dieser Zeit stieg Zürich auf, wo eine Königspfalz entstand.
Erst um 700 lässt sich das Wirken eines alamannischen Herzogs in Inneralamannien nachweisen: Gotfrid, dux Alemanniae, urkundete in Biberburg bei Cannstatt.66 Gotfrid schenkte auf Bitten eines Priesters Magulfus den Ort Biberburg an die Zelle des Heiligen Gallus. Sein Titel vir illuster, die Datierung nach Herzogsjahren sowie seine Anlehnung an den Merowingerkönig zeigen, dass sich der Dukat in einen gentilen Prinzipat verwandelt hatte. Vererbung und Teilung des Amts unter die Nachkommen sind Anzeichen für die Verselbstständigung des Herzogsamts. Erst nach dem Tod Gottfrieds 709 gelang es den karolingischen Hausmeiern Pippin dem Mittleren († 714) und Karl Martell († 741) nach Feldzügen in den Jahren 709 bis 712 zunächst Willihari und seinen Bruder Theudebald, dann auch Lantfrid (724-730) auszuschalten.
Karolinger, regnum Sueviae (ab 732)
Lantfrid hatte in der Neuredaktion (Recensio Lantfridana) des Alamannenrechts die starke Stellung des Merowingerkönigs betont. Nach seinem Tod versuchte Theudebald die Herzogswürde zu behaupten, wurde jedoch von Karl Martell 732 vertrieben.
Nach der Lex Alamannorum unterstanden die Grafen wie auch die Zentenare dem Herzog. Erst die Neuordnung Alemanniens unter Ruthard und Warin67 brachte um 760 einen drastischen Wandel, der unter Ludwig dem Frommen dahin führte, dass die karolingische Grafschaftsverfassung auf ganz Alemannien ausgedehnt wurde, das sich damit nicht mehr von den übrigen Gebieten des Frankenreichs unterschied. Karlmann, der ältere Sohn Karl Martells, erhielt neben Austrien und Thüringen auch Alemannien, von einer alamannischen Herzogswürde ist keine Rede mehr. Der Widerstand dagegen wurde erst 746 im Gerichtstag von Cannstatt gebrochen. Bis zum Wiederaufleben des „Schwäbischen Herzogtums“ Anfang des 10. Jahrhunderts verschwand der Herzogstitel.
Grundlage des neuen Herzogtums Schwaben war das regnum Sueviae, das Ludwig der Fromme für seinen Sohn Karl den Kahlen 829 aus den Dukaten Elsass, Alemannien und Rätien gebildet hatte und das im Vertrag von Verdun 843 an Ludwig den Deutschen und bei der Teilung von dessen Erbe an den jüngsten Sohn, Karl III. (den Dicken), fiel.
Siedlungsbewegungen und -typen
Archäologie und Sprachwissenschaft lassen die Siedlungsbewegung in den Interferenzzonen am Hochrhein, am Bodensee und im Bodenseerheintal erkennen. Entsprechende Einsprengsel gab es als isolierte Erscheinungen links des Rheins vom 4./5. Jahrhundert an, z.B. in Windisch-Oberburg oder im Gräberfeld von Kaiseraugst. Gegenüber den römischen Kastellen bezeugen „alamannische“ Gräberfelder des 5. Jahrhunderts eine Phase nicht-kriegerischen Kontaktes, so die Gräberfelder von Basel-Kleinhüningen und Basel-Gotterbarmweg gegenüber dem Castrum Basel oder Stein am Rhein gegenüber von Eschenz. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts scheinen große Teile der Oberschicht abgewandert zu sein, wohl nach Rätien, Italien oder nach Burgund. Links des Hochrheins lassen sich germanische Gruppen erst vom 2. Drittel des 6. Jahrhunderts an archäologisch nachweisen. Dieser erste Zuzug im linksrheinische Gebiet scheint fränkisch gewesen zu sein. Die entsprechenden Gräber in Basel-Bernerring, Zürich-Bäckerstrasse, Bülach und Elgg werden deren Amtsträgern zugeschrieben. Diese Orientierung blieb in der Nordostschweiz bis ins frühe 7. Jahrhundert vorherrschend, doch ab dem 2. Viertel des Jahrhunderts verstärkten sich die Einflüsse aus dem rechtsrheinischen alamannischen Kernland. Auch das Bodenseerheintal zeigt einen gestaffelten Prozess germanischer Ansiedlungen.
Die Ortsanemsforschung bestätigt diese relativ späte Zuwanderung. Innerhalb der Siedlungsnamen ist eine ältere Namenschicht (Formen: -ingen-, -heim- und -dorf) von den Namen eines ersten frühmittelalterlichen Ausbauraums (Haupttyp: -inghofen bzw. -ighofen, ikofen sowie -ikon) und denjenigen eines zweiten Ausbauraums (Formen: -wil und -wiler) zu unterscheiden. Innerhalb dieses Siedlungsraums finden sich Orte und Zonen, in denen das Romanische noch lange weiterlebte; Sprachgrenzstücke entstanden im 7./8. Jahrhundert erst in den Haupttälern. Die deutsch-romanische Sprachgrenze der Schweiz steht also in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der frühmittelalerlichen Siedlungsbewegung, sondern ist das Ergebnis einer noch Jahrhunderte währenden Entwicklung. Im Bereich der frühen alamannischen Besiedlung konzentrieren sich auch die althochdeutschen Landschaftsnamen.
Über die Bevölkerungszahl und -dichte lässt sich nichts aussagen, es sei denn, dass man auf eine Bevölkerungszunahme schließen kann, gelegentlicht auch auf eine, die über die der römischen Zeit hinausging.
Hierarchisierung der Gesellschaft, Grundherrschaft
Gehöfte und Weiler waren die hauptsächlichen Siedlungstypen, hölzerne Langhäuser, Grubenhäuser und Speicher dominierten die Ortsbilder. Die Hofanlagen waren umsäumt und umfassten laut der Lex Alamannorum neben dem Hauptgebäude mit beheizbarem Raum - weiter im Norden eher die Ausnahme - und Saal auch Speicher, Scheune, Bad- und Backstube, Kochhaus, Schaf- und Schweineställe, zuweilen gar eine wassergetriebene Getreidemühle.
In den frühen Gräbern, z.B. in Basel-Kleinhüningen, ist es die Qualität der Waffen und der Kleidung, die auf eine hierarchische Gesellschaft hinweist. Darin ist eine Oberschicht zu fassen, die sich im 7. Jahrhundert durch regionale Verankerung, Vererbbarkeit der Ämter, wachsende Bedeutung der Grundherrschaft und Verstärkung des Familien- und Gruppenbewusstseins sowie durch Verknüpfungen mit Kirchen- und Klostergründungen verfestigte und zum Adel wurde. Ihre reichen Gräber waren auf den Friedhöfen in aufwändigen Grabkammern (Elgg) sowie in der Bestattung bei oder in der Kirche, z.B. der reichen Dame, die um die Mitte des 7. Jahrhunderts in der Kirche von Bülach in vollem Ornat bestattet wurde, von den übrigen Toten abgesondert. Auch die kleinen Grabhügelnekropolen, wie bei Illnau-Grafstal (2. Hälfte 7. Jahrhundert) zeigen, dass ihre Herrschaft auf Landbesitz basierte, wie die frühen Urkunden des Klosters St. Gallen bezeugen. Die Grundherrschaft scheint die Verdrängung der extensiven, die Viehhaltung begünstigenden Feldgraswirtschaft durch die Dreifelderwirtschaft gefördert zu haben. Unter den Nutzpflanzen nahm der Dinkel den ersten Platz ein vor Gerste, Roggen, Hafer und Hirse sowie den Hülsenfrüchten Bohnen, Erbsen und Linsen. Auch der Obstbau und der von der galloromanischen Bevölkerung übernommene Weinbau wurden gepflegt.
Über den Fernhandel stand Alemannien mit Nordgallien und dem Rheinland, mit Italien und dem Nahen Osten, mit Böhmen und der Ostseeküste sowie mit den Donaugebieten in Kontakt. Die Bussenkataloge von Pactus und die Lex Alamannorum sagen über den Geldumlauf nichts aus, sind aber umso aufschlussreicher für die rechtsständische Gliederung Alemanniens: Die Gegenüberstellung von Freien und Unfreien ist schon differenziert und zwar durch die Mittelstellung der Halbfreien (Liten) oder Freigelassenen und durch die Untergliederung der Freien in die weniger vermögenden Freien (barones = minofledes), die mittleren (mediani) und jene der höchsten Gruppe (primi), welche die Urkunden primores, proceres oder nobiles nennen. Der Herzog erscheint als oberster Gerichtsherr, Garant des Friedens und militärischer Befehlshaber.
Christianisierung der Alamannen

Zu den spätantiken Bischofssitzen von Genf und Chur kamen um 600 alamannische. Außerhalb der Städte ging die Mission sehr langsam voran. Im Wallis ist sie als erste bemerkbar, denn dort breitete sich bereits im 5. Jahrhundert der Kult des heiligen Mauritius aus. Ab dem 6. Jahrhundert kamen irische Mönche als Missionare ins Land, unter ihren Gründungen ist Sankt Gallen. Dieses Kloster wurde zu einem der wichtigsten Macht- und Kulturzentren der Schweiz. In den Sphären der Macht und des Religösen blieb das Lateinische vorherrschend, aus dem sich allerdings parallel die Volkssprachen entwickelten.
Noch um 570 bezeichnete der byzantinische Geschichtsschreiber Agathias die Alamannen als Heiden, und um 610 traf Columban (der Jüngere), nicht der Missionar der Schotten, in Bregenz eine Mischbevölkerung mit synkretistischen Vorstellungen bzw. als Anhänger des Wodansglaubens an. Nach den späten Gallus-Viten hingen die Alamannen des Linthgebiets noch dem alten Götterglauben an.
In den Kastellorten südlich des Rheins lebte eine christliche Restbevölkerung. Die episkopale Ordnung war z.T. erschüttert - davon zeugen der Wechsel des Bischofssitzes von Augst nach Basel, wo um 615 ein Bischof nachzuweisen ist, bzw. die Verlegung des Bistums von Windisch nach Avenches und der weitere Rückzug nach Lausanne im 6. Jahrhundert. In Churrätien dagegen hat sie fortbestanden. Die Gründung des Bistums Konstanz zu Anfang des 7. Jahrhunderts machte es zum eigentlichen „Alemannenbistum“.
Die Relikte der Christianisierung sind rechts des Rheins zahlreicher als links, so etwa die Goldblattkreuze des 7. Jahrhunderts. Links des Rheins sind nun Kirchenbauten in Stein oder Holz, wie in Winterthur (der Vorgängerbau der heutigen Stadtkirche), dann die Kirchen mit alamannischen Stiftergräbern (Tuggen im Kanton Schwyz, Bülach im Kanton Zürich) Zeichen der Christianisierung. Auch gab man um 700 die Beigaben auf und die Gräber wurden in oder an die Kirchen (‚ad sanctos‘, zu den Heiligen) gebracht.
Die ersten Klöster entstanden in den Randzonen der romanisch-alamannischen Kontaktgebiete, so durch Fridolin, den Schutzpatron des Kantons Glarus, in Säckingen, dann durch Gallus in Steinach, wo unter Abt Otmar (719-759) das Kloster St. Gallen entstand, oder unter Germanus in Moutier-Grandval im Jura. Die weiteren Klostergründungen, etwa Pirmins († 755) in Pfungen, auf der Reichenau und in Murbach, oder jene im Gebiet des oberen Zürichsees (Lützelau, Benken) erfolgten in einer schon christianisierten Umgebung. Die Lex Alamannorum verweist auf eine Kirchenordnung, in der der Bischof, umgeben von Diakonen und Klerikern und unterstützt durch Pfarrpriester, die zentrale Rolle einnahm und in der selbst das Mönchswesen und die ständische Ordnung der Abhängigen berücksichtigt wurde. Die Grundzüge der kirchlichen Ordnung Alemanniens wurden unter den Karolingern weitgehend beibehalten.
Herzogtum Schwaben
Nach 900 entstand auf karolingischen Grundlagen das Herzogtum Schwaben, das bis Mitte des 13. Jahrhunderts als regnum bzw. ducatus Sueviae einen bedeutenden Herrschaftsraum bildete. Dieser erstreckte sich vom Oberrhein und von der Aare bis zum Lech im Osten, im Norden grenzte er an das Herzogtum Franken, im Süden reichte er tief in die Alpen hinein. Zu den wichtigsten Orten zählten im 10. Jahrhundert Zürich, der Hohentwiel, Breisach und Esslingen, ab dem 11. Jahrhundert kamen Ulm und Rottweil hinzu. Neben Konstanz waren Augsburg, Chur und Straßburg die wichtigsten Bistümer.
Entstehung
Anders als in Sachsen oder Bayern konkurrierten in Alemannien mehrere Adelsfamilien miteinander. 911 versuchte Markgraf Burkhard von Rätien sich in der Königspfalz Bodman zum dux bzw. princeps Alemannorum aufzuschwingen, wurde jedoch nach einem nicht allgemein anerkannten Urteil hingerichtet. Im Konkurrenzkampf wurde die Familie Burkhards durch Tötung oder Exilierung ausgeschaltet. Die Söhne Burkhard und Ulrich wurden in die Verbannung geschickt, der Bruder Adalbert III. wurde auf Anstiften des Konstanzer Bischofs Salomo III. getötet. Danach strebten die Pfalzgrafen Erchanger und Berthold nach der Herzogswürde, während Salomo eine Zwischeninstanz zwischen den Großen und dem König ablehnte, wie sie ein Herzog dargestellt hätte.
913 brach aus unbekannten Gründen ein Streit zwischen Erchanger und Konrad aus. Er wurde im Herbst beigelegt und der Friedensschluss durch die Ehe des Königs mit Erchangers Schwester Kunigunde besiegelt. 914 nahm Erchanger Bischof Salomo gefangen, den Vertreter königlicher Interessen in Alemannien, wurde dann aber selbst von Konrad in die Verbannung geschickt. In dieser Situation kehrte der jüngere Burkhard zurück und begann seinerseits gegen den König zu rebellieren. Daraufhin belagerte Konrad vergeblich den von Burkhard besetzten Hohentwiel. Erchanger kehrte aus seinem Exil zurück und schloss mit Burkhard ein Zweckbündnis. Im Januar 917 setzte der König seine Widersacher Erchanger, Berthold sowie dessen Neffen Liutfrid gefangen und ließ sie am 21. Januar 917 enthaupten, obwohl sie zur deditio (Unterwerfung) bereit waren - ein schwerer Verstoß gegen das sonst übliche Verhalten. Der schwäbische Adel erhob daraufhin den bisherigen Gegner Burkhard zum Herzog. Dieser nahm alle Besitztümer Erchangers an sich und wurde als Herzog in ganz Schwaben anerkannt.
Sein Sohn Burchard II., der seine Herrschaft mit seinem Sieg über König Rudolf II. von Hochburgund bei Winterthur 919 konsolidierte und damit dessen Expansion gegen Osten ein Ende setzte, wurde um 920 auch von König Heinrich I. als Herzog anerkannt, dem Nachfolger Konrads.
Unterwerfung durch Heinrich I. (920), Konradiner (ab 926), Aufstieg Zürichs
Laut Widukind brach Heinrich unmittelbar nach seiner Königswahl zu einem Feldzug gegen Burkhard von Schwaben auf. Dabei scheint sich Burkhard ohne Widerstand noch 919 „mit allen seinen Burgen und seinem ganzen Volk“68 dem neuen König unterstellt zu haben. Heinrich begnügte sich mit der Vasallität des Herzogs und verzichtete auf direkte Herrschaftsausübung, wobei er Burkhard die Verfügungsgewalt über den Fiskus und königliche Rechte über die Reichskirchen überließ. Allerdings wurde ihm keinesfalls gänzlich die Kirchenhoheit überlassen.69 Bis zu Burkhards Tod im Jahr 926 hat Heinrich Schwaben nicht mehr betreten.70
926 setzte Heinrich mit dem Konradiner Hermann einen Landfremden zum Herzog ein und überging damit den noch unmündigen Sohn Burkhards. Hermann war ohne eigene Hausmacht in Schwaben und dadurch, so das Kalkül des Königs, stärker von Heinrich abhängig, der so die Kirchenherrschaft an sich ziehen konnte.71 Zürich wurde neben dem Hohentwiel zum wichtigsten Ort, von dem aus der Herzog als Stellvertreter des Königs seinen ducatus beherrschte. Dort hielt er seine Hoftage. Er verfügte über das Reichsgut, darunter die Pfalz im Lindenhof in Zürich, über die Bischofskirchen, die Reichsklöster Zürich, Zurzach, Reichenau und St. Gallen, hinzu kamen Einkünfte aus Zoll, Markt und der herzoglichen Münzstätte in Zürich sowie über die Grafschaften. Rätien, unter Burchard noch eine Grafschaft, die in einer Art Personalunion mit der Herzogsgewalt verbunden war, wurde unter Burchards Nachfolger Hermann I. (926-49) in drei Grafschaften aufgeteilt, nämlich Oberrätien, Vinschgau und Unterrätien. Unterrätien blieb dabei bis 982 in der Hand der Herzöge. Hermann förderte sein Eigenkloster Einsiedeln, dem König Otto I. 947 auf sein Ersuchen die Reichsunmittelbarkeit verlieh. Otto seinerseits sicherte sich damit nach der Angliederung Italiens an das Reich den Durchzug durch Schwaben.
Der Ottone Liudolf (950-54), Burchardinger
Ida, Tochter des Herzogs Hermann von Schwaben, des Anführers der ihm treu gebliebenen Konradiner, verheiratete der König 947/48 mit seinem Sohn Liudolf, dem er zugleich die Nachfolge im Königsamt einräumte. Dadurch wertete er Hermann auf und sicherte seinem eigenen Haus die Nachfolge im Herzogtum, da Hermann keine Söhne hatte. 950 wurde deshalb Liudolf wie geplant Herzog von Schwaben.
Doch nun trat Adelheid auf den Plan. Sie war nicht nur Witwe des italienischen Königs, sondern auch Nichte der Ida von Schwaben, der Frau von Ottos Sohn Liudolf. Da der König seit 946 Witwer war, ergriff er die Möglichkeit, Adelheid zu heiraten und damit seine Herrschaft nach Italien auszudehnen, während sich Adelheid gegen ihre italienischen Widersacher, vor deren Führer Berengar II., der seit 950 König war, sie geflohen war, nun zur Wehr setzen konnte. In Pavia wurden Otto und Adelheid im Oktober 951 getraut.
Doch die Ehe führte zu Spannungen zwischen dem König und Schwabenherzog Liudolf, seinem Sohn. Nachdem Adelheid im Winter 952/953 einen ersten Sohn zur Welt gebracht hatte, soll Otto ihn statt Liudolf als Nachfolger gewollt haben.72 Im März 953 begann in Mainz der Aufstand Liudolfs, dem sich viele Adlige anschlossen, schließlich auch Bayern. Die Ungarn erkannten diese innere Schwäche und fielen im Frühjahr 954 mit einer großen Streitmacht in Bayern ein - Liudolf veranstaltete am Palmsonntag des Jahres 954 in Worms - am Ende sein größter Fehler - ein Gastmahl zu Ehren der Ungarn. Daraufhin vermittelten die Bischöfe Ulrich von Augsburg und Hartpert von Chur, beide engste Vertraute des Königs, ein Treffen zwischen den Konfliktparteien am 16. Juni 954 auf einem Hoftag.73 Obwohl ihn seine wichtigsten Verbündeten wegen des Verhaltens gegenüber den Ungarn verließen, kämpfte Liudolf weiter. Der Konflikt wurde erst durch die deditio, ein Unterwerfungsritual, im Herbst 954 beigelegt.74 Die Schlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 beseitigte die Ungarngefahr dauerhaft. Nach diesem Sieg kam es im Reich bis zu Ottos Tod im Jahr 973 nicht mehr zu Erhebungen der Großen gegen den König, wie sie bis dahin wiederholt aufgeflammt waren. Liudolf wurde Ende 956 nach Italien geschickt, um dort Berengar II., König von Italien 950–61, zu bekämpfen, doch erlag er schon am 6. September 957 einem Fieber.
Schwaben erhielt 954 einen neuen Herzog, nämlich Adelheids Onkel Burkhard. Der König ließ im Mai 961 seinen minderjährigen Sohn Otto II. zum Mitkönig erheben, und zog nach Rom, wo er 962 zum Kaiser gekrönt wurde, Adelheid zur Kaiserin. Nach langen Kämpfen und der Durchsetzung eines neuen Papstes kehrte der Kaiser zurück. Doch in Italien kämpfte nun Adalbert, der Sohn Berengars, um die Königskrone Italiens, so dass der Kaiser Herzog Burkhard von Schwaben gegen ihn entsenden musste. 966 zog Otto erneut nach Italien, diesmal nicht über den Brenner sondern über Chur. Sein Sohn heiratete 972 die byzantinische Prinzessin Theophanu.
Herzöge von Schwaben und Elsass, Dynastiebildung
973-994 bestanden zwei herzogliche Gewalten nebeneinander. Auf dem Hohentwiel residierte Hadwig, Witwe von Burchard III., die über die Klöster Reichenau und St. Gallen verfügte. Kaiser Otto II. hatte jedoch die Herzöge Otto und Konrad eingesetzt. Der Herzog verlegte, wie auch sein Sohn und Nachfolger Hermann II., den Schwerpunkt seiner Herrschaft nach Straßburg. Daher trugen sie den Titel Herzog von Schwaben und Elsass. Otto war der einzige Sohn Liudolfs von Schwaben und seiner Frau Ida, Tochter Herzog Hermanns I. von Schwaben. Otto war somit ein Enkel Kaiser Ottos I. Er war ab 973 Herzog von Schwaben und ab 980 von Bayern. Er überlebte zwar am 13. Juli 982 bei Crotone in Kalabrien die Niederlage des Reichsheeres unter Otto II. in der Schlacht am Kap Colonna gegen die Sarazenen, doch auf den Rückweg erlag er seinen Verletzungen. Ihm folgte Konrad I. im Amt des Schwaben- und Elsässerherzogs („dux Alemannorum et Alsatiorum“) bis 997.
Nachdem Schwaben 1025-30 durch die Rebellion von Herzog Ernst II. gegen Kaiser Konrad II. schwer erschüttert worden war, stand das Herzogtum 1038 bis 1045 unter direkter Verwaltung König Heinrichs III., der sich mindestens sechs Mal in Zürich aufhielt.
Erste einheimische Herzöge, Investiturstreit, Schwaben und Zähringer
1057 kam die Herzogswürde wieder an einen einheimischen Großen, nämlich an Rudolf von Rheinfelden, vielfach auch Rudolf von Schwaben genannt. Er übte ab 1033 im Königreich Burgund, das dem Reich angegliedert worden war, die Herrschaft aus.
Wie überall spalteten sich die Adelsfraktionen angesichts des Investiturstreits zwischen Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. 1079 bis 1098 standen sich zwei Herzöge gegenüber. Auf kaiserlicher Seite war dies der Staufer Friedrich I., auf päpstlicher zunächst Berchtold von Rheinfelden, Sohn des 1077 zum Gegenkönig erhobenen Rudolf, dann ab 1092 Berchtold II. von Zähringen.
Erst der Ausgleich zwischen diesen Familien von 1098 führte zu einer Neuordnung. Sie hatte zur Folge, dass sich der Amtsbereich des Herzogs von Schwaben um die Gebiete Breisgau, Ortenau und Baar verkleinerte, die fortan dem Herzog von Zähringen unterstanden, ebenso wie Zürich. Die Zähringer, seit 1127 im Besitz des Rektorats Burgund, dehnten ihren Einflussbereich ab 1130 von Zürich bis in die Waadt aus. Das neue Herzogtum von Zähringen stand in keiner lehnsrechtlichen Beziehung mehr zum Herzog von Schwaben. Kennzeichnend war die Herrschaft über den edelfreien Adel, um Zürich etwa über die Herren von Regensberg, von Wart, von Rapperswil und von Tegerfelden. Das Herzogtum Schwaben blieb hingegen ab 1098, abgesehen von einer kurzzeitigen Unterbrechung, in der Hand der Staufer. Zu seinen Vasallen zählten auf Schweizer Gebiet die Grafen von Kyburg, von Baden, von Lenzburg, von Nellenburg und von Habsburg.
Verwicklung in Reichskämpfe und den Kampf zwischen Kaiser und Papst
Zähringer (bis 1218) und Staufer, Ende des Herzogtums Schwaben
Infolgedessen wurden die Zähringer zum entscheidenden regionalen Machtfaktor. Neben ihren beiden Stadtgründungen Freiburg im Breisgau und Bern hielten sie die Reichsvogtei Zürich, zu der Uri gehörte. Heinrich II. stattete die Zähringer mit der Grafschaft im Breisgau aus - es folgten eheliche Verbindungen mit den Staufern und Herzog Hermann IV. von Schwaben. Berthold III. erhielt die Zusage auf das Herzogtum Schwaben, doch erhielt stattdessen Rudolf von Rheinfelden 1057 diese Würde. 1061 wurde er mit dem Herzogtum Kärnten entschädigt, sein Sohn Hermann wurde Markgraf von Verona und amtierte bis 1073 als Graf im Breisgau.75
Gegen Heinrich IV. schlossen sich mehrere Fürsten, darunter die Zähringer, zur süddeutschen Fürstenopposition zusammen, woraufhin der Zähringer 1077 seines Amtes enthoben wurde. Sein Sohn Berthold II. setzte in dieser Zeit des übergreifenden Investiturstreits zwischen römisch-deutschen Herrschern und den Päpsten die antikaiserliche Politik seines Vaters fort. Er heiratete Agnes, die Tochter Rudolfs von Rheinfelden. Dadurch, dass sein Schwiegervater kinderlos starb, gelangte er 1090 an das reiche, vor allem in Burgund gelegene Rheinfeldener Erbe. In dieser Zeit wurde die Burg Zähringen im Breisgau zum Familiensitz, die der Familie bald den Namen gab; gleichzeitig begann der Ausbau wichtiger Städte, wie etwa Freiburg im Breisgau. 1092 wurde Berthold II. gegen den Widerstand der Staufer zum Herzog von Schwaben gewählt.
1098 wurde als Ersatz für das bei den Staufern verbleibende schwäbische Herzogtum das Herzogtum Zähringen (ducatus Zaringiae) gegründet, das aus den Eigengütern der Familie und verschiedenen Reichslehen bestand; die Zähringer verzichteten dabei keineswegs auf den Titel eines Herzogs. Dafür erhielt der Zähringer Zürich als Reichslehen. Sowohl Berthold II. († 1111) als auch sein Sohn Berthold III. († 1122) unterstützten fortan die Ansprüche der spätsalischen Herrscher. Sein Nachfolger Konrad († 1152) heiratete Clementia von Namur und konnte somit seinen Herrschaftsbereich noch weiter Richtung Südwesten ausdehnen. Im Jahr 1127 erhielt er das Rektorat über Burgund.
Die Staufer gaben den Anspruch auf Schwaben nie ganz auf, daher blieben die Beziehungen zu den Zähringern während des 12. Jahrhunderts gespannt. So überfiel im Februar 1120 Konrad von Zähringen das Kloster Allerheiligen und die Stadt Schaffhausen, räumte diese dann aber auf Druck Heinrichs V. und des Papstes. 1146 kam es zu einer Fehde mit den Staufern, insbesondere mit Friedrich Barbarossa. Barbarossa, Sohn Herzog Friedrichs II. von Schwaben und selbst ab 1147 Herzog, eroberte umgekehrt 1146 Zürich und zog in den Breisgau, musste seine Eroberungen aber nach Interventionen seines Vaters und seines Onkels Konrad III. wieder aufgeben. 1152 wurde Barbarossa zum König erhoben, doch trat er Schwaben zunächst an seinen unmündigen Vetter Friedrich IV., den Sohn König Konrads III., ab, blieb jedoch für Schwaben zuständig. Nach dem Tod Friedrichs IV. durch die Malaria, die er sich in Italien zugezogen hatte, gelangte Schwaben 1167 wieder an Kaiser Barbarossa. Es wurde zum Kronland der staufischen Dynastie.
Barbarossa engte den Einfluss der Zähringer auf den östichen Teil zwischen Jura und Alpen ein. Berthold IV. erhielt als Entschädigung zwar Vogtei und Regalieninvestitur in den Bistümern Genf, Lausanne und Sitten, doch die Spannungen verschärften sich. Berthold bot dem französischen König gar Unterstützung gegen die Staufer an, wogegen Barbarossa die Scheidung von Clementia, Bertholds Schwester, von Heinrich dem Löwen betrieb - offenkundig, um die zähringisch-welfische Allianz zu schwächen. Doch bald verbesserte sich das Verhältnis zwischen Berthold und Barbarossa, so dass er den Kaiser auf seinen Italienzügen begleitete. 1173 belehnte ihn der Kaiser mit dem Erbe der Lenzburger, die vor allem in der Ostschweiz sowie im Aargau ihren Schwerpunkt gehabt hatten, und er erlangte die Vogtei über die Kirchen in Zürich. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs VI. (1197), des Nachfolgers Barbarossas, wurde Herzog Berthold V. von Zähringen als Thronkandidat ins Gespräch gebracht, doch blieb der Zähringer dem bereits festgesetzten Wahltermin in Andernach 1198 fern. Gegen Vogtei und Herrschaft über Kloster und Stadt Schaffhausen und die staufische Besitzhälfte an Breisach, unterstützte er den staufischen Kandidaten. Neben der Machtpolitik förderte er die Kultur, etwa durch den Neubau des Freiburger Münsters oder über Dichter, wie Berthold von Herbolzheim.
Der Silberbergbau im Schwarzwald bildete eine wichtige Grundlage, die allerdings nur gegen den Widerstand des Bischofs von Basel durchsetzbar war. Die Zähringer betrieben in ihrem Einflussbereich eine intensive Siedlungspolitik und gründeten Städte, Dörfer und Klöster.
Für ein Kennzeichen der Zähringerherrschaft wurde der Stadtgrundriss mit dem so genannten „Zähringer-Straßenkreuz“ gehalten: Zwei Straßenzüge, die sich annähernd rechtwinklig kreuzen, teilen das Stadtgebiet in vier Quartiere. Meist war demnach die eine Achse als Marktgasse breiter ausgebildet.76 Zu diesen Städten zählen beispielsweise Bern (1160/91), Burgdorf, Bräunlingen, vor allem Freiburg im Breisgau, Freiburg im Üechtland (gegründet 1157), Haslach im Kinzigtal, Murten, Neuenburg am Rhein, vielleicht Offenburg, Rheinfelden, Thun und Villingen.
Die Hauptlinie der Zähringer starb mit dem Tod Bertholds V. 1218 aus. Ansprüche auf das Erbe erhoben die Grafen von Urach und die Grafen von Kyburg, in deren Familien Schwestern Bertholds eingeheiratet hatten, dann die Herzöge von Teck und der Staufer Friedrich II.
Im Zusammenhang mit den Italienzügen und dem Investiturstreit war die Bedeutung der Pässe über die Alpen für eine weit ausgreifende Machtpolitik enorm angewachsen, so dass sich die Staufer, die immer wieder mit den italienischen Kommunen und dem Papst in Konflikt gerieten, hier besonders absichern mussten. Schon unter Konrad III. wurden um 1150 die Lenzburger im Bleniotal am Südausgang der Straße über den 1915 m hohen Lukmanierpass mit den Reichsrechten betraut, doch starben diese 1173 aus. An ihre Stelle traten die Herren da Torre als staufische Amtsträger. Zum Konflikt zwischen Friedrich Barbarossas und dem gräflichen Adel kam es, als dieser 1157 im Streit um die Zugehörigkeit der Grafschaft Chiavenna zwischen Schwaben und dem Bistum Como die Wahrung der Ehre des Herzogtums forderte. Barbarossa stärkte zur Sicherung der Route über den Lukmanier das Kloster Disentis. Graf Rudolf von Pfullendorf, ein Anhänger der Staufer, war Hochvogt des Churer Bistums. Er übertrug 1170 die Hochvogtei auf den Sohn Barbarossas, Friedrich V. von Schwaben. Die Hochvogtei ermöglichte den staufischen Herzögen noch einmal eine Verwaltung in Churrätien einzurichten.
Friedrich II. setzte nach seiner Wahl 1212 seinen Sohn Heinrich (VII.) als Herzog von Schwaben ein, der dieses Amt auch als König bis zu seiner Entmachtung 1235 fortführte. Nach einer kurzen Phase der Verwaltung durch Reichsministerialen gelangte Schwaben 1237 an König Konrad IV. Papst Innozenz IV. bot Graf Ulrich von Württemberg und seinem Vetter Hartmann von Grüningen bares Geld und jeweils die Hälfte der Einkünfte des Herzogtums Schwaben, um sie auf die Seite seines Kandidaten für den Königsthron zu ziehen. Tatsächlich entschied ihre Fahnenflucht 1246 die Schlacht zugunsten von Heinrich Raspe, doch die Verfügung über das Herzogtum blieb an das Königtum gebunden.
In der Schweiz wurden weitere wichtige Grundlagen für einen überaus weitreichenden Konflikt gelegt. Dort behielt die kaiserliche Partei, zu der neben der älteren Linie der Habsburger die Städte Zürich, Bern, Schaffhausen und Konstanz sowie die Fürstabtei St. Gallen zählten, die Oberhand. Schon beim Aussterben der Zähringer 1218 waren die an das Reich zurückfallenden Reichslehen nicht an die mächtigen Kyburger vergeben worden, sondern an weniger hochgestellte Familien, wie die Reichsvogtei Uri an die Habsburger. Der Kaiser versuchte so, eine größere Machtkonzentration in der Ost- und der Zentralschweiz zu verhindern. Daher blieben einige Städte und Talschaften beim Reich, Uri erhielt 1231 ebenso Privilegien wie Schwyz 1240. Erst Friedrichs Tod im Jahr 1250 eröffnete diesen adligen oder korporativen lokalen Herrschaftsgebilden neue Möglichkeiten.
Zu dieser Zersplitterung trug bei, dass Schwaben in nachstaufischer Zeit nicht mehr als Herzogtum vergeben wurde. Stattdessen wurden seit Rudolf von Habsburg die staufischen Reichsrechte und -güter in Reichsvogteien organisiert. Daneben kam den Reichsstädten eine wachsende Bedeutung zu. Im Gegensatz zum übrigen süddeutschen Raum, wo die Macht der Städte von Landesfürsten gebrochen wurde, konnten sich auf Schweizer Gebiet mächtige Stadtherrschaften etablieren, ähnlich wie in Italien.
Habsburger, Schwerpunktverlagerung nach Österreich
Die Nachfolger der Zähringer wurden also letztlich nicht die Staufer sondern die Habsburger, die 1273 mit Rudolf von Habsburg erstmals einen römisch-deutschen König stellten, nachdem die Staufer in Süditalien 1266 und 1268 schwere Niederlagen erlitten hatten. Ihm war es bereits 1264 gelungen, das Erbe der Kyburger an sich zu ziehen, die in der Nord- und Ostschweiz begütert waren und deren Stammburg südlich von Winterthur im Kanton Zürich lag.
Als Herrschaftsmittelpunkt wurde um 1020 die Burg Habsburg errichtet, die sich in der gleichnamigen Gemeinde Habsburg im Kanton Aargau befindet. Graf Otto II. († 1111) war der erste, der sich von Habsburg nannte. Im 11. und 12. Jahrhundert bauten die Habsburger ihre Territorien aus. Sie erwarben Vogteien und Grafschaftsrechte und wurden so Landgrafen im Oberelsass (Sundgau) und Vögte des Straßburger Hochstifts und beanspruchten das Erbe der Grafen von Kyburg, so dass sie Ländereien im Zürichgau, in Schwyz, Unterwalden, im Aargau, Frickgau und in Uri in Besitz nahmen, die später als ihre Stammlande galten.
Die erste Hausteilung fand 1232 statt. Albrecht IV. († 1239) war der Begründer der älteren und Rudolf III. († 1249) der der Habsburg-Laufenburgischen Linie, die von 1232 bis 1408 bestand. Rudolf III. kämpfte zunächst auf staufischer Seite in Italien, wandte sich aber nach dem Konzil von Lyon, das sich gegen Friedrich II. richtete, vom Kaiser ab. Er stritt bis zuletzt mit seinem Neffen und späteren König Rudolf I., der staufer-treu blieb, während er auf päpstlicher Seite stand. Er förderte die Johanniter durch Zollbefreiungen und Schenkungen, förderte Laufenburg, das durch den Vater als Konkurrenz zu Schaffhausen und Nellenburg zur Stadt erhoben worden war. Die Laufenburger Besitzungen befanden sich im Frickgau mit dem Sitz auf der Burg Laufenburg, im Albgau mit der Burg Hauenstein, im Aargau mit der Burg Stein sowie in Obwalden, der Ostschweiz und in der Grafschaft Klettgau. Doch Rudolf III. gelang es nicht, ein eigenes Herrschaftszentrum in der Innerschweiz aufzubauen. Spätere Versuche wurden häufig von der älteren Linie durchkreuzt, die unter Rudolf IV., dem Sohn Albrechts IV., ihre Herrschaft auf den Schwarzwald ausdehnen konnte. Durch das Kyburger Erbe konnte er zudem die Ost- und Nordostschweiz für sich gewinnen. Seine Wahl zum römisch-deutschen König 1273 als Rudolf I. stärkte zwar seine Stellung, lenkte die Energie der nunmehr dominierenden Habsburger Linie jedoch auf andere Gebiete, insbesondere nach dem Ableben König Ottokars II. im Jahr 1278. Nun expandierten die Habsburger Richtung Nieder- und Oberösterreich, sowie Steiermark und Kärnten.
Durch die Heirat Rudolfs III. († 1315) mit Elisabeth von Rapperswil, der Schwester des letzten Grafen von Rapperswil, erbte Johann I. die umfangreichen Besitzungen der Rapperswiler im Zürichgau und die Stadt Rapperswil. Johann wurde 1336 wegen seiner Schulden in die Auseinandersetzungen um die Zürcher Zunftrevolution hineingezogen und kam 1337 in der Schlacht bei Grynau gegen den Zürcher Bürgermeister Rudolf Brun ums Leben. Johann II. beteiligte sich 1350 an dem Versuch (Zürcher Mordnacht), Bürgermeister Brun in Zürich zu stürzen, weil ihm dessen Gegner einen Schuldenerlass zugesichert hatten. Der Plan wurde jedoch verraten, und der Graf geriet dadurch in Zürich im Wellenberg für drei Jahre in Gefangenschaft. Die Festungen in Rapperswil und Altendorf wurden von Brun zerstört. Er wurde zwar wieder freigelassen, musste jedoch 1354 seine Güter am oberen Zürichsee an Herzog Albrecht von Österreich verkaufen und der Stadt Zürich Urfehde schwören.
Verselbstständigung, Reichsunmittelbarkeit
Das Aussterben mächtiger Adelsgeschlechter sowie die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst sowie zwischen den mächtigsten Adelsfamilien begünstigten im 13. Jahrhundert die Verselbstständigung der Städte und Talschaften der Schweiz. Dabei erlangten einige von ihnen zunächst die Reichsunmittelbarkeit und damit einen gewissen Schutz vor dem Ehrgeiz des regionalen Adels. 1218 wurden Zürich, Bern, Freiburg und Schaffhausen nach dem Aussterben der Zähringer zu Reichsstädten; der Kanton Uri erlangte 1231, die Gemeinde Schwyz 1240 ebenfalls die Reichsunmittelbarkeit.
Damit sicherte Kaiser Friedrich II. den Weg über den Gotthard, um 1230 wurde der Gotthardpass durch den Bau der Teufelsbrücke zu einer Handelsstraße; die Bündner Pässe waren allerdings weiterhin wichtiger. Dies geschah während er im Krieg mit den lombardischen Städten stand, die auf päpstlicher Seite kämpften. Er sicherte sich die Loyalität der Schweizer Städte im Kampf gegen Papst Innozenz IV. Nachdem Friedrich 1245 vom Papst gebannt und für abgesetzt erklärt worden war, hielten auch Bern, Basel und Zürich zum Kaiser.
Eidgenossenschaft
Grundlagen und Entstehung
Vielleicht schon zwischen 1240 und 1290, urkundlich fassbar im August 1291, verbanden sich Uri, Schwyz und Nidwalden durch Eidesleistung. Dabei standen Waffenhilfe nach außen, sowie die Einrichtung eines Schiedsverfahrens für innnere Konflikte im Vordergrund. Nach dem Sieg über die Habsburger in der Schlacht am Morgarten von 1315 entstand darüber hinaus eine gemeinsame Militär- und Bündnispolitik.
Eine Eidgenossenschaft zu bilden war keineswegs eine seltene oder gar einmalige Angelegenheit, jedoch wurde die von 1291 sicherlich die bekannteste. Der Begriff selbst taucht erst in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf und bezeichnet als Schweizerische Eidgenossenschaft, Confoederatio helvetica (oder analog in einer der vier Landessprachen), bis heute den Bundesstaat, der nach revolutionären Umbrüchen 1798-1848 entstand. Von „Eidgenossen“ sprach man schon im 13. Jahrhundert, von der „Schweizerischen Eidgenossenschaft“ vereinzelt ab dem 16. Jahrhundert. Dabei fehlt in den lateinisch-romanischen Bezeichnungen, wo die coniuratio eher eine Verschwörung meinte, das Element des Eides. 1351 taucht die Bezeichnung als „Eidgenossenschaft“ im Bund der Orte Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern mit Zürich auf. Die Eidgenossenschaft - als durch höchste Schwüre geschaffene wechselseitige Verpflichtung gleichberechtigter Teilhaber - stand in scharfem Gegensatz zur Organisation feudaler Herrschaft, die sich auf Huldigung und Gottesgnadentum stützte, eben nicht auf gleichberechtigte Teilhabe.77
Ab 1353 bestand die alte Eidgenossenschaft aus acht, von 1513 bis 1798 aus dreizehn vollberechtigten Stadt- und Länderorten (Kantone), dazu etwa einem Dutzend minderberechtigter Zugewandter Orte (Städte, Fürstentümer und die föderal strukturierten Republiken Graubünden und Wallis), schließlich den nie von allen Orten verwalteten Gemeinen Herrschaften und einigen Schirmherrschaften. Dieses komplexe Bündnissystem war durch zahlreiche Allianzen mit auswärtigen Mächten vernetzt.

Das Bündnis von 1351 wurde 1352 zum Muster für das mit Zug und Glarus und 1353 mit Bern. Einige der acht Orte waren nicht unmittelbar miteinander verschworen - so etwa Bern nicht mit Luzern, Zürich, Zug und Glarus, Glarus seinerseits nicht mit Luzern und Zug. Zwischen ihnen bestanden nur separate Absprachen in den Beibriefen oder in separaten Verträgen.
Bei den älteren Eidgenossenschaften standen Friedewahrung und militärische Hilfeleistung gegen lokale Adlige oder gegen Territorien wie Savoyen, Burgund, Habsburg oder Mailand im Vordergrund, da die ansonsten hierfür zuständige Reichsgewalt verfiel. So entstand die Burgundische Eidgenossenschaft unter der Führung der Reichsstadt Bern. Basel, ebenfalls Reichsstadt, richtete sich nach Norden aus, hingegen waren Zürich, Schaffhausen und St. Gallen auf den Bodenseeraum ausgerichtet. Dabei traten Mitglieder beider Städtegruppen zugleich dem Rheinischen Bund von 1254, dem Schwäbischen Bund von 1376/85 oder dem Elsässischen Städtebund von 1379 bei.
Ähnlich wie in Zürich 1336 stiegen im Laufe des 14. Jahrhunderts in den meisten Orten neue, dank Handel und Krieg aufgestiegene nichtadlige Familien mit Hilfe der Landsgemeinde und der Zünfte auf. Sie verdrängten den Adel von der Macht. Die an die Macht drängende Bürgerschaft der habsburgischen Landstadt Luzern suchte 1332 Rückhalt bei den Ländern, wie die Bürger Zürichs 1351, die damit ihre 1336 nach Vertreibung der Adligen durchgesetzte Zunftverfassung absicherten. Es folgten gewaltsam entstandene Bündnisse mit Zug (1352, 1365) und Glarus (1352, 1393). Die Verbindung mit der burgundischen Eidgenossenschaft wurde durch den Ewigen Bund mit Bern 1353 erreicht. Nun wurde die aus acht Orten bestehende Eidgenossenschaft als dauerhaftes Machtgebilde wahrgenommen.
Wachstum und Ortehierarchie (1353-1515), Deutschsprachigkeit, Burgunderkriege, Konsolidierung


Dem Bündnis kamen neue Bünde zustatten, wie zwischen Zürich und Glarus 1408, Bern und Luzern 1406 und 1421, dann Zürich und Bern 1423. Der Pfaffenbrief von 1370 schloss vor allem geistliche Gerichte aus und enthielt ein Verbot der Fehde. Im Sempacherbrief von 1393 wurde nach den Siegen von Sempach 1386 und Näfels 1388, an denen erstmals alle acht alten Orte, dazu Solothurn, mitgekämpft hatten, verfügt, dass kein Ort ohne Zustimmung der andern Krieg anfangen dürfe.
Auch auf der Reichsebene gelangen große Erfolge. Antihabsburgische Herrscher, wie die Luxemburger Karl IV. und Wenzel erkannten 1360-62 und 1376-79 ihre Rechte an, obwohl dies der Goldenen Bulle von 1356 zuwiderlief, die alle Verschwörungen und Verbindungen untersagt. Alle deutschen Städtebünde wurden 1389 aufgelöst.
Die Expansion erfolgte durch Gewalt, Kauf, Pfandschaft, aber auch durch Burg- und Landrechte mit Städten, Herren und Landschaften. Die Eroberungen und Pfandschaften gehörten als gemeine Herrschaften den acht (Aargau 1415-1798) bzw. sieben Orten (Thurgau 1460-1798) und nicht der Eidgenossenschaft als solcher.
Die von 1416-1797 fast jedes Jahr durchgeführten Jahrrechnungen trugen erheblich zur Verstetigung der Konferenzen bei, die sich von der fallweisen Vermittlung von Konflikten zur wichtigsten Institution der Eidgenossenschaft, der Tagsatzung, entwickelten. Die zugewandten Orte hatten, im Gegensatz zu den acht alten Orten, in diesem Gremium keinen festen Sitz und Stimme sowie keinen Anteil an den gemeinen Herrschaften.
Als existenzgefährendend erwies sich 1442 Zürichs Bündnis mit den Habsburgern, genauer gesagt mit König Friedrich III. Auslöser war der Streit zwischen Zürich, Schwyz und Glarus um die Erbschaft der Grafen von Toggenburg (Alter Zürichkrieg). Schwyz und die eigenössischen Orte machten Zürichs Seitenwechsel ebenso rückgängig, wie den von 1393. Die im Zürcher Bund garantierte Bündnisfreiheit bestand nicht mehr.
Die letzte Erweiterung erfolgte durch die Aufnahme der fünf neuen Orte 1481-1513 und die Eroberung von Gebieten, die als gemeine Herrschaften der sieben (Sargans 1483-1798, Rheintal 1490-1798), zwölf (gemeineidgenössiche Tessiner Vogteien 1512, 1515-1798), zweieinhalb (Uri, Schwyz, Nidwalden in Riviera, Blenio, Bellinzona 1500/03) oder zwei Orte (Bern und Freiburg in Grandson, Murten, Orbe-Echallens ab 1475 bzw. 1484) integriert wurden.
Selbst vor Mailand machte dieses System nicht halt, über das 1513 bis 1515 ein Protektorat errichtet wurde. Auch die militärische Eroberung und der diplomatische Verlust der Freigrafschaft Burgund 1513 hätten diesen Rahmen wohl gesprengt, auch wenn die Schweizer Söldner als die besten Europas galten.
Genau von diesen aufstandsartigen Auszügen von Innerschweizer Söldnern im Gefolge der Burgunderkriege (1474-77), in denen die Schweizer dieses enorme Machtgebilde zwischen Frankreich und dem Reich zerschlugen, fühlten sich die Städteorte Zürich, Bern und Luzern bedroht. Daher schlossen sie ein ewiges Burgrecht mit den Städten Freiburg und Solothurn. Dies lehnten jedoch die Länderorte als Erweiterung der Eidgenossenschaft durch Städte ab (Burgrechtsstreit 1477-81). Der Vermittlung des Einsiedlers Niklaus von Flüe war es zu verdanken, dass die beiden Machtblöcke 1481 das Stanser Verkommnis schlossen. Es regelte die Verteilung der Beute, die gegenseitigen Hilfspflicht - nun auch wichtig für den Fall innerer Revolten - und garantierte die Territorien. Für die zuugewandten Orte galt das Verkommnis ohne jede Mitsprache. Zugleich verweigerten die Länderorte den beiden neuen Mitgliedern Freiburg und Solothurn bis 1501 die Mitsprache an den Tagsatzungen und bis 1526 die gleichberechtigte Beschwörung der Bünde. Das zweisprachige Freiburg wickelte den Verkehr mit den Eidgenossen auf deutsch ab - die mehrsprachige Schweiz entstand trotz zahlreicher französisch- und italienischsprachiger Untertanengebiete und trotz entsprechender Zugewandter erst 1798.
Die expansionistische Politik der Stadt Bern, die in der heutigen Westschweiz selbst Zentrum einer burgundischen Eidgenossenschaft war, hatte die nur lose zusammengefügte Eidgenossenschaft in eine erste Konfrontation auf europäischer Ebene mit dem burgundischen Herzog Karl dem Kühnen geführt. Die Burgunderkriege endeten mit einem aufsehenerregenden Sieg der Eidgenossenschaft und begründeten den Ruf der Schweizer Söldner. Das Reislaufen, der Kriegsdienst in fremdem Sold, bildete seitdem einen wichtigen Bestandteil der Wirtschaft der Alten Eidgenossenschaft, besonders in der Innerschweiz.


Nach dem Sieg über Burgund war die Eidgenossenschaft zur vorherrschenden Macht im süddeutschen Raum geworden. Der schwäbische Adel, allen voran Habsburg, versuchte dem wachsenden Einfluss der Eidgenossen in Mitteleuropa im Waldshuterkrieg 1468 und im Schwabenkrieg 1499 vergeblich entgegenzutreten. Im Schwabenkrieg ging es zwar vordergründig um eine Durchsetzung der Reichsreform von 1495, aber eigentlich war dies der letzte Versuch des Hauses Habsburg, sich durchzusetzen. Im Frieden zu Basel musste König Maximilian I. 1499 die faktische Selbstständigkeit der Eidgenossenschaft innerhalb des Reiches anerkennen. Die Zugehörigkeit der Eidgenossen zum Reich blieb aber bis 1648 formal bestehen.
Der habsburgisch-französische Gegensatz zog die Eidgenossenschaft als Hauptlieferantin von Söldnern an beide Kriegsparteien sowie als eigenständige Macht erneut in einen Konflikt auf europäischer Ebene. In den Ennetbirgischen Feldzügen im Rahmen der Mailänderkriege zwischen 1499 und 1525 fand die militärische Bedeutung der Eidgenossenschaft sowohl ihren Höhe- als auch ihren Endpunkt. Die Feldzüge nach Italien blieben vorerst siegreich und brachten der Eidgenossenschaft die Herrschaft über das Tessin und das Veltlin sowie das kurzlebige Protektorat über das Herzogtum Mailand.
Die Nordgrenze der Eidgenossenschaft wurde durch die ewigen Bünde mit Basel und Schaffhausen von 1501 nach dem Schwabenkrieg von 1499 festgelegt. Militärische Unterstützung von 1499 bis 1513 hatte zur Folge, dass Appenzell als dreizehnter und letzter Ort in die Eidgenossenschaft aufgenommen wurde, während Abt und Stadt St. Gallen gegen ihren Wunsch weiterhin Zugewandte blieben. Auch wurde das lange als gleichsam eidgenössisch geltende Konstanz 1548 österreichische Landstadt. Die fünf neuen Orte blieben von den alten gemeinen Herrschaften ausgeschlossen, waren in ihrer Bündnisfreiheit eingeschränkt und auf die Vermittlung der alten Orte angewiesen. Basel, Schaffhausen und Appenzell waren zugleich zu Neutralität und Vermittlung in innereidgenössischen Konflikten verpflichtet.
Mit dem Ende der militärischen Erfolge im Jahr 1515 endete die Expansion, sieht man von der Eroberung der Waadt durch Bern und Freiburg im Jahr 1536 ab. Der Beginn der Reformation entzweite die Orte der Eidgenossenschaft noch sehr viel stärker als bisher und schwächte ihre Position in den Streitigkeiten zwischen Habsburg, dem Papst und Frankreich. 1515 besiegte der französische König Franz I. ein durch den Abzug zahlreicher Kantone dezimiertes eidgenössisches Heer in der Schlacht bei Marignano. In der traditionellen Schweizergeschichte endete damit die expansionistische Phase der Eidgenossenschaft und machte einer Neutralität aus innerer Schwäche Platz. Ob angesichts der Soldbündnisse mit Frankreich von Neutralität gesprochen werden kann, ist jedoch umstritten. Der Export von Söldnern durch verschiedene eidgenössische Orte hielt bis zum endgültigen Verbot 1859 an. Einzige Ausnahme bildet seither die päpstliche Schweizergarde.
Konfessionalisierung, Reformation und Gegenreformation (ab 1515); Inquisition und Hexenverfolgung

Der 1484 in Wildhaus im Kanton St. Gallen geborene Huldrych Zwingli begann in Zürich ab 1519 eine Reform durchzuführen, die zur Gründung der Reformierten Kirche führte.79 1498 hatte er sich an der Universität Wien immatrikuliert, 1502 an der von Basel. 1506 war er als Priester geweiht und nach Glarus berufen worden. 1516 begegnete er Erasmus von Rotterdam, einem der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. 1513 begleitete er die Glarner Truppen nach Novara und 1515 nach Marignano als Feldprediger. 1516 wurde er Leutpriester im Kloster Einsiedeln, wo er gegen Ablasshandel und Reisläuferei predigte, wie man die Legionärstätigkeit nannte. Seine weitere Entwicklung wurde von den Briefen des Apostels Paulus auf Griechisch geprägt, ebenso wie durch das Johannesevangelium in der Deutung von Augustins Werken.
Zwingli predigte ab 1519 als Leutpriester am Grossmünster in Zürich, wo er die Pest überlebte. Er wandte sich gegen das Söldnerwesen (Ein göttliche Vermanung an die ersamen, wysen, eerenvesten, eltisten Eydgnossen zuo Schwytz, 1522) die Verehrung von Bildern, Reliquien und Heiligen, gegen Zölibat und Eucharistie. 1522 kam es zum Konflikt mit dem Bischof, als man sich auf sein Verhältnis zum Fastengebot berief; Zwingli reagierte mit der nunmehr reformierten Schrift, in der er das Schrift- gegen das Traditionsprinzip wendete: Vom Erkiesen und Fryheit der Spysen. Maßstab aller Dinge wurde nun der Text der Bibel.
Zwingli forderte 1522 das Ende des Priesterzölibats und die Einführung der schriftgemäßen Predigt (Supplicatio ad Hugonem episcopum Constantiensem), noch im August des Jahres bestritt er in seiner Schrift Apologeticus Archeteles grundsätzlich dessen Zuständigkeit. Es kam zur 1. Zürcher Disputation im Januar 1523, in deren Folge der Rat von Zürich seine Lehre anerkannte.
Es folgte die 2. Disputation im Oktober, die zur Abschaffung der Messe, der Entfernung der Bilder, der Aufhebung der Klöster, der Neuorganisation der Armenfürsorge und der Errichtung eines unabhängigen Ehegerichts führte. Die reformierten Pfarrer erhielten ein Lehrinstitut, aus dem die Hohe Schule hervorging. Unter Zwinglis Leitung erarbeitete man dort die Zürcher Bibel. Den radikaleren Anhängern Zwinglis gingen die behutsam durchgeführten Reformen nicht weit genug. Unter ihnen waren Konrad Grebel, Felix Manz und Jörg Blaurock, die sich schließlich dem Täufertum zuwandten. Der Rat bekämpfte diese Gruppen. Es entstanden Zwinglis bedeutsamste Schriften: Von götlicher und menschlicher Grechtigkeit (1523) und sein systematisches Hauptwerk De vera et falsa religione commentarius (1525). Unter dem Einfluss der ersteren Schrift mischte sich die Geistlichkeit immer mehr in die Gesellschaft ein, und Zwingli versuchte, seine Vorstellungen in der gesamten Eidgenossenschaft durchzusetzen (1528 Disputation in Bern). 1530 wandte er sich mit Fidei ratio sogar an Kaiser Karl V., 1531 mit Fidei expositio an den König von Frankreich. Zürich stand auf der Seite der französisch-deutschen Koalition gegen Habsburg und den Papst. Bald folgten die Städte Basel, Schaffhausen und St. Gallen dem Zürcher Beispiel ebenso wie Bern. In den Landständen Appenzell, Glarus und in den Drei Bünden sowie im Thurgau, im Rheintal und in der Fürstabtei St. Gallen konnte sich die Reformation ebenfalls weitgehend durchsetzen.
Die Landstände in der Innerschweiz, die mit dem Papst verbündet waren und sich gegen die Stadtkantone wehrten, entfremdeten sich angesichts der starken Führungsrolle der Städte Bern und Zürich in einer reformierten Eidgenossenschaft. Im Unterschied zu den Handelsstädten im Mittelland war die dortige Führungsgruppe in der Innerschweiz zudem auf das Söldnerwesen angewiesen.
Der Streit mit Martin Luther über das Abendmahl (Über D. Martin Luters Buch, Bekentnuss genannt 1528), insbesondere über die Art der Anwesenheit Christi, konnte auch auf dem Marburger Religionsgespräch von 1529 nicht beigelegt werden. Der Protestantismus begann sich endgültig in verschiedene Richtungen aufzuspalten. Die aggressive Politik Zürichs gegen die reformationsfeindlichen Teile der Eidgenossenschaft führte zum Zweiten Kappelerkrieg von 1531, in dem Zwingli umkam. Sein Erbe wurde unter seinem Nachfolger Heinrich Bullinger trotz einiger Modifikationen fortgeführt. Zwinglis Biograph Oswald Myconius setzte ein heroisches Bild des Reformators in die Welt, das in Zürich noch Jahrhunderte nachwirkte.
Die Streitigkeiten zwischen den katholischen und den reformierten Ständen über die Verbreitung der Reformation in den Gemeinen Herrschaften führten zu den beiden Kappelerkriegen zwischen Zürich und den Innerschweizer Kantonen in den Jahren 1529 und 1531. Im Zweiten Kappeler Landfrieden vom 20. November 1531 wurde festgesetzt, dass die Religionshoheit den Kantonen zukam, die sich entscheiden konnten, welche Konfession in ihrem Herrschaftsgebiet gelten sollte. So setzte Bern 1536 mit Zwang in den neu eroberten Gebieten im Waadtland die Reformation durch. Weiter wurde die Ausbreitung der Reformation in den Gemeinen Herrschaften gestoppt. Als religiös gemischte Gebiete wurde unter anderen das Toggenburg anerkannt. In den Drei Bünden blieb die Wahl der Religion den Gerichtsgemeinden überlassen, weshalb sich dort ein religiöser Flickenteppich entwickelte. Die Auseinandersetzung zwischen den Religionen dauerte dort noch bis ins 17. Jahrhundert an.

Als letzte Stadt führte durch den Einfluss Berns 1541 Genf (seit 1526 Zugewandter Ort) die Reformation ein. Dies führte zu einer weiteren Aufspaltung des Protestantismus, denn der dortige Reformator Jean Calvin, geboren 1509 im französischen Noyon und bekannt als Johannes Calvinus, eigentlich Jean Cauvin, begründete mit seiner besonders strengen Auslegung der Bibel den nach ihm benannten Calvinismus. Ende 1533 musste Calvin Paris verlassen, weil er sich für die Reformation erklärt hatte. Schließlich ließ er sich in Basel nieder, doch als er sich im Juli 1536 in Genf aufhielt, überzeugte ihn Guillaume Farel, in der soeben für die Reformation gewonnenen Stadt zu bleiben. Er wurde wenige Monate später Pfarrer, doch wurden die beiden Männer 1538 im Streit um das Abendmahl verbannt. Nun ging Calvin nach Straßburg, wo er 1540 den ersten seiner zahlreichen Bibelkommentare publizierte. 1540 bis 1541 nahm er mit Martin Bucer an den Religionsgesprächen von Worms und Regensburg teil und befreundete sich mit Philipp Melanchthon, dem „Praeceptor Germaniae“ (Lehrer Deutschlands). Calvin wurde noch 1540 zurückberufen, ließ aber mehr als zehn Monate auf sich warten.
1541 bis 42 verfasste er drei theologische Schriften, nämlich die Ordonnances ecclésiastiques, den Genfer Kathechismus und die Forme des prières (Form der Gebete) als Grundlagen für die Verfassung, die Liturgie und die Lehre der Genfer Kirche. Calvin unterschied zwischen Pfarrern, Lehrern (‚docteurs‘), den Ältesten, die für die Disziplin zuständig waren, und den Diakonen, die im Spital- und Almosenwesen tätig waren. Die Compagnie des pasteurs diente der Weiterbildung der Amtsträger und führte die Aufsicht. Das Konsistorium, dem die Pfarrer und die aus dem Stadtrat gewählten Ältesten angehörten, die in dem Gremium die Mehrheit stellten, überwachte die Einhaltung der Sitten- und Glaubensregeln. Im Gegensatz zu den Konsistorien von Zürich und Bern konnte es auch Exkommunikationen aussprechen, ein Recht, das bis 1557 umstritten war. Calvins Tausende von Predigten zogen zahlreiche Flüchtlinge nach Genf. Von 1535 bis 1562 wuchs die Bevölkerung von 10.000 auf 23.000. Das Druckergewerbe wurde zu einem wichtigen Wirtschaftszweig.
Calvin, erst 1559 eingebürgert, gründete in diesem Jahr die Genfer Akademie als Hochschule des reformierten Glaubens, die Genf zu einem „protestantischen Rom“ machte. Die Akademie wurde erst 1873 zur Universität Genf erweitert. Seine Professoren und Studenten machten Genf zur Bildungshauptstadt des französischsprachigen Protestantismus. Der Calvinismus verbreitete sich in Frankreich (Hugenotten), England (Puritaner), Schottland und den Niederlanden und von dort aus bis nach Nordamerika. Während in der Eidgenossenschaft durch die Zusammenarbeit des Zürchers Heinrich Bullinger mit Calvin im Consensus Tigurinus von 1549 eine Einigung in der Abendmahlfrage zwischen Reformierten und Calvinisten erfolgte, verhärteten sich die Fronten zwischen Reformierten und Lutheranern weiter. Der Calvinismus breitete sich bis ins 17. Jahrhundert weiter aus, vor allem in den führenden Gruppen und in den Städten Deutschlands und Osteuropas. Im Unterschied zu Luther waren für Calvin alle Bibelteile durch den Heiligen Geist inspiriert, weshalb er dem Alten Testament mehr Bedeutung zumaß. Entsprechend der grundlegenden Idee vom auserwählten Volk, der die Lehre der doppelten Prädestination Calvins nicht unähnlich war, bestimmt Gott, welche Menschen Erwählte und welche auf ewig Verdammte sind. Diese sind Ausdruck der göttlichen Barmherzigkeit bzw. der göttlichen Gerechtigkeit. Gottes Gnade erkannte man am irdischen Erfolg, was zu Überlegungen führte, ob Calvins Lehre nicht Ausdruck oder Anstoßer einer kapitalistischen Mentalität war, in der vor allem der messbare Erfolg zählte.
Die Verurteilung Luthers durch Papst Leo X. und die von Kaiser Karl V. verhängte Reichsacht der Jahre 1520 und 1521 konnten die Reformation nicht aufhalten. Doch die Tagsatzung beschloss 1524 in Luzern, dem alten Glauben treu zu bleiben, Gegenmaßnahmen erfolgten im selben Jahr in Freiburg und 1525 von der Ständeversammlung der Waadt. Auch als die Badener Disputation 1526 zugunsten des alten Glaubens ausging, ließ Graubünden die Reformatoren gewähren, Bern verbot die Messe 1528, Basel und Glarus 1529.
Die katholischen Orte schlossen 1529 ein Bündnis mit dem Wallis (dem Bischof von Sitten und den Zenden)80 und eines mit dem König von Böhmen und Ungarn. Ihr Sieg im Jahr 1531 - Zwingli starb - verschaffte den Altgläubigen ein politisches Übergewicht in der Eidgenossenschaft. Dieses Übergewicht konnten sie durch größere Einigkeit und durch Unterstützung durch die katholischen Großmächte bis 1712 aufrechterhalten. Luzern führte zwischen 1532 und 1542 das untere Seetal zum Katholizismus zurück. Auf katholischer Seite zu erwähnen ist der Walliser Kardinal Matthäus Schiner als einflussreicher Berater des jungen Kaisers Karl V., der mit seiner Papst-Kandidatur nur knapp scheiterte.

Als Initialzündung der Gegenreformation gilt die Visitationsreise des italienischen Kardinals Carlo Borromeo in der Eidgenossenschaft von 1570, der dem reformbereiten Flügel des Katholizismus starke Impulse gab. 1574 wurde in Luzern die erste Jesuitenschule eröffnet und 1579 in Mailand das Collegium Helveticum, eine Universität für katholische Schweizer Priester im Sinne des Konzils von Trient. 1586 ließ sich der päpstliche Nuntius für die Eidgenossenschaft, Giovanni Francesco Bonomi, in Luzern nieder und die Kapuziner wurden in die Schweiz gerufen. Die katholischen Orte hatten zuvor Allianzen mit dem Herzog von Savoyen 1560 sowie mit Papst Pius IV. 1565 geschlossen. 1586 unterzeichneten sie den Goldenen Bund zur Verteidigung ihres Glaubens. Die Weltmacht Spanien trat ihm 1587 bei, Appenzell (Innerrhoden) 1597, Katholisch-Glarus 1635. Die konfessionelle und politische Spaltung wurde 1586 durch den Goldenen Bund der sieben katholischen Kantone eine Dauereinrichtung. In den Hugenottenkriegen in Frankreich kämpften die Eidgenossen je nach Konfession in unterschiedlichen Lagern.
Bis ins 17. Jahrhundert wurden durch die Gegenreformation weite Gebiete der Eidgenossenschaft zurückgewonnen, besonders in der Nordwestschweiz (Bistum Basel) und in der Ostschweiz (Fürstenland, Uznach, Gaster, Sargans). Ludwig Blarer gewann als Abt Einsiedeln zurück. Obwohl sie dort nur ein Drittel der Bevölkerung stellten, verdrängten in Appenzell die Katholiken ab 1590 die Reformierten. Ihr Bestreben, den Kanton dem Goldenen Bund zuzuführen, bewirkte letztlich seine Spaltung, der Kanton Appenzell teilte sich 1597 in zwei Halbkantone. Für die Glarner Katholiken (ein Viertel der Bevölkerung) bemühte sich Aegidius Tschudi um die rechtliche Gleichstellung. 1623 und 1683 half ihnen eine ausgewogene Verteilung der hohen Verwaltungsämter, sich aus der Stellung als minderberechtigte Bürger zu befreien.
Durch die Reformation wurde die Eidgenossenschaft stark geschwächt, da gemeinsame Beschlüsse der reformierten und katholischen Orte in der Tagsatzung praktisch unmöglich wurden. Die katholischen Orte trugen sogar dazu bei, dass reformierte Orte Gebiete verloren. So zwang etwa eine Allianz Savoyen mit den katholischen Orten, Bern und Wallis 1567/69 das Chablais und das Pays de Gex, das sie 1536 erobert hatten, wieder an Savoyen abzutreten. Die vollständige Aufnahme der verbündeten reformierten Städte Mülhausen, Genf, Straßburg und Konstanz in die Eidgenossenschaft wurde ebenfalls durch die katholischen Orte verhindert. Trotzdem konnte sich das reformierte Genf gegen die savoyardischen Übergriffe (Escalade 1602) behaupten.
Die Zweiteilung der Eidgenossenschaft entlang der Konfessionsgrenzen wurde 1602 durch ein Soldbündnis der Dreizehn Orte ohne Zürich mit Frankreich wieder etwas gemildert. Der Schwerpunkt der europäischen Politik in Hinblick auf die Eidgenossenschaft verschob sich auf die Drei Bünde, wo seit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 Spanien und Frankreich um die Kontrolle der Alpenpässe kämpften. Dadurch wurde Graubünden, in das 1620 Spanier einmarschierten, während der Bündner Wirren 1618–1641 als einziges Land der Eidgenossenschaft durch den mörderischen Krieg verheert. Die Dreizehn Orte verweigerten den Drei Bünden den Beistand, nur Bern und Zürich intervenierten 1620 kurzzeitig und erfolglos direkt in Graubünden.
Die Eidgenossenschaft als ganzes blieb während des Krieges, der sich über drei Jahrzehnte hinzog, zwar neutral, stellte jedoch Frankreich – die katholischen Orte auch den Spaniern – vertragsgemäß Söldner. Jede Parteinahme hätte den Bürgerkrieg und damit das Ende der Eidgenossenschaft bedeutet. 1634 stand ein Bündnis Zürichs und Berns mit Schweden kurz vor dem Abschluss und die katholischen Orte verhandelten mit Spanien. Allein die schwedische Niederlage bei Nördlingen verhinderte 1634 den Bürgerkrieg. Im Defensionale von Wil, der ersten eidgenössischen Wehrverfassung, beschlossen die Dreizehn Orte 1647 die bewaffnete Neutralität. In wirtschaftlicher Hinsicht profitierten viele Gegenden sogar vom Krieg, da die Preise für Nahrungsmittel wegen der weitreichenden Verwüstungen in Deutschland und Italien stark stiegen. Dies galt weniger für den Bodensse, wo fast alle das Seeufer beherrschenden Mächte – im Norden und Osten das katholische habsburgische Vorderösterreich und im Nordwesten und Westen die bis zum See zusammen mit dem verbündeten Königreich Schweden und dem Königreich Frankreich vorgedrungenen Truppen des protestantischen Herzogtums Württemberg – aus strategischen Gründen die Hegemonie über den Bodenseeraum zu erlangen suchten; dies galt vor allem für die Jahre 1632 bis 1634 und 1642 bis 1648.
Genf musste 1601 im Vertrag von Lyon zwischen Frankreich und Savoyen dem Herzog seine um die Stadt gelegenen Ländereien zurückgeben, bis auf das Pays de Gex, das französisch wurde. Diese Gebiete kehrten unter dem Einfluss von Franz von Sales und der Kapuziner zum Katholizismus zurück. Doch der Angriff Karl Emanuels I. von Savoyen von 1602 auf Genf selbst scheiterte.
Die weiter oben erwähnte Inquisition war durch Papst Gregor IX. (1227-41) 1231 zur richterlichen Verfolgung der Katharer, die Rom als Häretiker betrachtete, in Südfrankreich eingerichtet worden. Ihre Leitung wurde zwei Jahre später den Bettelorden überantwortet, insbesondere den Dominikanern. Dieser Orden erhielt 1267 den Auftrag, die Inquisition im Westen des Reiches, in den Bistümern Genf, Lausanne, Sitten, aber auch Besançon, Toul, Metz und Verdun einzurichten.
In Lausanne, Genf und Sitten begann die Verfolgung der Häretiker erst in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, beginnend in Freiburg, wo 1375 die Beginen vom Freien Geist sowie 1399 und 1430 die Waldenser verfolgt wurden. Zu einer Dauereinrichtung wurde die Inquisition in den besagten Diözesen unter dem Dominikaner Ulric de Torrenté († 1445) der 1438 in Dommartin und im folgenden Jahr in Neuenburg erste Hexenprozesse durchführte. Im Bistum Genf betätigten sich in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts Dominikaner des örtlichen Konvents als Vizeinquisitoren, ab Beginn des 16. Jahrhunderts als unabhängige Inquisitoren.
Obwohl Bern zum Bistum Lausanne gehörte, zog die Stadt zur Bekämpfung der Waldenser 1399 den Basler Dominikaner Nikolaus Rosenbusch von Landau bei. Im Bistum Basel ist nach dem Dominikaner Werner von Pontis 1400 nur Heinrich Institoris 1482 als Inquisitor belegt. In Luzern betätigte sich 1403 der „Ketzermeister“ Heinrich Angermeier. Aus dem observanten Dominikanerkonvent Basel stammte Heinrich Ryss, der 1483 als Prior des Dominikanerkonvents Chur und Inquisitor der Diözese belegt ist.
Auch die weltlichen Mächte begannen Hexenprozesse zu führen. In der Leventina wirkte bis 1432 die oberitalienische Inquisition der Lombardei und der Mark Genua, ab 1457 das Talgericht. Mit der Reformation verschwand die Inquisition in der Schweiz.
Dort fanden etwa 10.000 der insgesamt nach einer groben Schätzung 110.000 Hexenprozesse statt. Ihre Wurzeln finden sich neben der Dauphiné im Gebiet der Westschweiz. Dies hing mit den Freiburger Waldenserprozessen von 1399 und 1430 zusammen, die von der Lausanner Inquisition geführt wurden. Die Kleinteiligkeit der Machtverhältnisse begünstigte die Ausnutzung derartiger Prozesse, um die eigene Machtposition zu stärken, nachweislich 1465 in Châtel-Saint-Denis im Kanton Freiburg.
Die mittelalterlichen Hexenverfolgungen fanden um 1430 im Wallis statt, dann in Freiburg und Neuenburg (um 1440), in Vevey (1448), im Bistum Lausanne (um 1460), wiederum am Genfersee (um 1480) und in Dommartin (1498 und 1524-1528). Da es in der Westschweiz eher um die Bekämpfung von Häretikern ging, war der Anteil der Frauen verhältnismäßig gering, ähnlich wie in der Leventina 1432 und 1457-59. In der Deutschschweiz hingegen, vor allem in Luzern, handelte es sich um reine Malefizprozesse, also um den Kampf gegen Schadenszauber, dem kein Konzept von Hexensekte und -sabbat zu Grunde lag, wie in der Westschweiz.
Sowohl in den katholischen wie in den reformatorischen Landesteilen nahm die Zahl der Hexenprozesse erst im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts vehement zu und nahm Mitte des 17. Jahrhunderts wieder ab. Schwerpunkte waren die Waadt (1580-1655) mit etwa 1.700 Verurteilungen und Graubünden mit mehr als 1.000 Prozessen. Eine verstärkende Wirkung wird dabei der zersplitterten Blutgerichtsbarkeit zugewiesen, denn Orte mit einer zentralisierten Blutgerichtsbarkeit wiesen weniger Prozesse auf. So fanden in Zürich zwischen 1478 und 1701 „nur“ 79 Hinrichtungen statt.
Die Anklage vor den meist weltlichen Gerichten kam überwiegend aus der Bevölkerung und lautete meist auf Schadenszauber. Spezifisch für die Schweiz ist die geringe Beachtung der Vorschriften der Reichsordnung für die Strafgerichtsbarkeit von 1532, der Carolina. Die zur Anordnung der Folter vorgeschriebene Aktenversendung an eine juristische Fakultät oder eine vorgesetzte Behörde war dort unüblich. In der Schweiz war zudem der Anteil der Frauen besonders hoch, der auf 65 bis 95 % geschätzt wurde. Die Glarnerin Anna Göldi wurde als letzte Hexe 1782 verurteilt. Ihre Hinrichtung wird seit 2008 als Justizmord betrachtet, kein Denkmal erinnert bisher an die Opfer.
Jüdische Gemeinden
Römerreich bis Hochmittelalter
Als ältester Beleg für die Anwesenheit von Juden in römischer Zeit gilt ein Fingerring aus Augusta Raurica mit der Abbildung des siebenarmigen Leuchters, der wohl aus dem 2. bis 4. Jahrhundert stammt.81 Auch finden Juden Erwähnung in der Lex Burgundionum (nach 500), doch fassbar ist die Gemeinde erst nach 1150. Die Zuwanderung erfolgte vom Oberrhein und aus Frankreich und Savoyen. Seit der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts sind Juden in Genf belegt, 1213 in Basel, später in Zürich, St. Gallen, dann im Bodenseeraum, in Bern und Solothurn, am Ende des 13. Jahrhunderts im Aargau und in Luzern, um 1300 schließlich in Biel und Neuenburg.
Schutzbriefe, Judenregal, Arbeitsbeschränkungen
Ihre Existenz mit all ihren Beschränkungen hing von der Gunst der Obrigkeit ab. Juden unterstanden ab 1236 als sogenannte Kammerknechte dem Schutz des römisch-deutschen Königs und Kaisers; dieser vergab das Judenregal an Städte, die den Juden gegen die Judensteuer zeitlich befristete Schutz- und Bürgerbriefe ausstellten. In Zürich mussten sie Darlehen an Stadtbürger geben und Abgaben auf ihr Vermögen, das Judengeleit, den Leibzoll, den Würfelzoll und das Grabgeld entrichten. In einigen Städten, so auch in Zürich, durften sie mit Einverständnis des Rates ein Haus erwerben, in anderen nicht. Biel erlaubte 1305 den Erwerb von zwei Häusern, Schaffhausen gestattete dies 1435.

Im Spätmittelalter sind Synagogen in Basel, Diessenhofen, Genf, Lausanne, Luzern, Murten, Schaffhausen, Solothurn und Zürich belegt. In der Blütezeit der zweiten Zürcher Gemeinde - zwischen 1384 und 1393 - dürften rund 20 Familien mit etwa 100 Angehörigen dort gelebt haben. Jeder 50. Züricher war also Jude. In Genf waren es um 1400 immerhin 13 Familien. In Bern lebten Juden in der durch ein Tor abgeschlossenen Judengasse. Das einzige Ghetto der Schweiz entstand in Genf in den 1420er Jahren.
Die Juden wurden vor allem für Geldgeschäfte, Pfandleihe und Heilkunde eingeplant, sie durften jedoch weder im Handwerk noch in der Landwirtschaft tätig sein. Bekannt sind jüdische Ärzte wie Vibranus de Turre und Meister Ackin aus Vesoul in Freiburg. Soziale Ausgrenzung und Marginalisierung bedrohten immer wieder die Gemeinden. Der Zugang zu politischen Ämtern und Zünften war ihnen verwehrt. Sexuelle Kontakte mit Christinnen wurden mit drakonischen Strafen geahndet.
Als wichtigstes Werk der Schweiz gilt der Zürcher Semak, ein hebräischer Kommentar des Rabbi Moses ben Menachem zum Sefer Mizwot Katan, dem Kleinen Buch der Gebote des Isaak ben Josef von Corbeil aus dem 14. Jahrhundert. Juden beherrschten die Landessprachen und Westjiddisch. Christliche Hebraisten der Reformationszeit korrespondierten mit jüdischen Gelehrten wie Elia Levita.
Pogrome, Vertreibungen (1348, 1491)
In Bern kam es 1294 zu einem Pogrom, das, wie so oft unter dem Vorwurf des Ritualmords begann. Doch erst die Pest mit ihren gesellschaftlichen Umwälzungen führe ab 1348 zu einer Welle der Gewalt. Mindestens 28 Gemeinden gingen auf dem Gebiet der Schweiz in Pogromen zwischen 1348 und 1350 unter. Ihnen wurde vorgeworfen, die Brunnen vergiftet zu haben, wobei Bern bei der Weitervermittlung des Brunnenvergiftungsgerüchts von den französisch- in die deutschsprachigen Gebiete eine aktive Rolle spielte.
In Zürich wurde die Gemeinde um 1354, in Freiburg 1356, in Basel 1362, in Schaffhausen 1369/70, in Biel und Bern 1375 wiederhergestellt, doch sie waren nunmehr unbedeutend. In Schaffhausen sind 49 Angehörige, in Stein am Rhein 29 und in Rheineck zwei Juden urkundlich fassbar. Ihre Rechte und ihre wirtschaftliche Lage verschlechterten sich um 1400 weiter, in Zürich durften sie ab 1404 nicht mehr vor Gericht gegen Christen aussagen. Erneute Vorwürfe des Ritualmordes führten zur Flucht und 1401 zu neuen Pogromen in Diessenhofen, Schaffhausen sowie Winterthur. Nach etwa 1450 wurden die Juden, die ab etwa 1400 nach und nach ihre Bedeutung als Geldverleiher verloren hatten, aus den Städten verjagt.
1489 beschloss die Tagsatzung die Ausweisung aus der ganzen Eidgenossenschaft für das Jahr 1491, ein Jahr vor der Vertreibung aus Spanien. Nur noch einzelne Ärzte hielten sich länger im Lande auf. Auch aus den letzten geschützten Orten, wie Andelfingen, wurden sie 1495 vertrieben, spätestens 1496 aus Rheinau.
Ländliche Gemeinden (ab Ende 16. Jahrhundert)
Erst Ende des 16. Jahrhunderts lassen sich Juden in den Regionen um Basel, im Sundgau und um Waldshut und Zurzach fassen, ab spätestens 1580 auch im Bodenseeraum und im angrenzenden Rheintal. Insgesamt entstanden 17 jüdische Landgemeinden. Zwei weitere entstanden in Endingen und Lengnau im Surbtal in der Grafschaft Baden, einer gemeinen Herrschaft der Eidgenossen, in der die Ansiedlung der Juden ausnahmsweise geduldet wurde. Dies galt ansonsten nur für Solothurn und das Fürstbistum Basel. Südddeutsche und elsässische Flüchtlinge hatten eine Nische im Landhandel gefunden. Sie betätigten sich als Hausierer, Makler, Tuch-, Vieh- und Pferdehändler und waren im Kleinhandel in den Grenzregionen von Neuenburg über Basel und den Aargau bis in den Thurgau und St. Gallen tätig, weil ihnen andere Berufe nicht offenstanden. Es entstanden Friedhöfe - ein Indikator für eine gewisse Kontinuität -, wie in Zwingen (1572-1673, Nachfolgefriedhof ab 1673 Hegenheim bei Basel), Sulzburg i.Br. (um 1550), auf dem Judenäule bei Waldshut (um 1607, Nachfolgefriedhof zwischen Endingen und Lengnau ab 1750), in Gailingen (1655). Die 1694 aus dem Fürstbistum Basel, 1736 aus Dornach, 1742 aus Stühlingen vertriebenen Juden fanden in der weiteren Umgebung neue Schutzherren.
Die Gemeinden bildeten religiöse und Wohlfahrtsinstitutionen aus. Lengnau und Endingen bauten sich 1750 bzw. 1764 Synagogen, wie sie sonst nur in den bedeutendsten fränkisch-schwäbischen Landgemeinden üblich waren. Ab dem 17. Jahrhundert hatte das Surbtal immer mindestens einen Rabbiner. 1780 zählten beide Gemeinden zusammen 659 Mitglieder.
Besonderheiten der Schweizer Gemeinden, wie der Hoolegrasch-Brauch, erhielten sich vereinzelt bis in die jüngste Zeit. Die Feiertage waren ein kollektives Erlebnis und auch für Christen wahrnehmbar. Deren Kinder besuchten zu Jom Kippur die Synagoge. Viele Ausdrücke des Jiddischen wurden von der sonstigen Dorfbevölkerung übernommen. Neben Friedhof und Synagoge wurde oft ein Tauchbad (Mikwe) und ein Schächthaus errichtet. „Betteljuden“, die von weither kamen und Neuigkeiten berichteten, und die auch als „Schnorrer“ bezeichnet wurden, erhielten Naturalverpflegung (Pletten) oder wurden in Herbergen untergebracht.
Die Schutzbriefe, die den Familienvorständen ausgestellt wurden, galten zwölf bis sechzehn Jahre. Abgaben für deren Erneuerung, aber auch für die Benutzung von Weide, Brunnen und Waldungen, dann Kopfgelder, „Geschenke“ für Beamte usw. hielten die Juden arm. Die Städte blieben ihnen zum wohnen bis zum 19. Jahrhundert verschlossen. Zu Märkten und Messen wurden die Juden offiziell zugelassen.
Dreißigjähriger Krieg und Graubünden, Kämpfe zwischen Frankreich-Venedig und Spanien-Österreich
In den Bündner Wirren von 1618 bis 1639 zwischen den Koalitionen Frankreich-Venedig und Spanien-Österreich stritt man um Graubünden. Dabei ging es hauptsächlich um die Kontrolle der Bündner Alpenpässe, aber genauso um die konfessionelle Ordnung im Lande. Den Auftakt bildete der Veltliner Mord vom 18. und 19. Juli 1620, als italienische Söldner unter Ritter Giacomo Robustelli ins Veltlin eindrangen und die dortige katholische Führungsschicht für einen Aufstand gegen ihre mehrheitlich reformierten Landesherren gewannen. Rund 500 Protestanten wurden ermordet und Hunderte von Angehörigen der Bündner Führungsschicht flohen aus dem Veltlin, darunter alle evangelischen Prädikanten. Veltin und Bormio richteten eine Regierung ein mit Robustelli an der Spitze, die mit Schreiben an die europäischen Herrscher um ihre Anerkennung ersuchte.
Die Bündner zogen nun mit einigen Regimentern über Chiavenna und den Murettopass ins Veltlin, wurden jedoch am 8. August 1620 bei Morbegno geschlagen. Spanier und Österreicher sicherten die Pässe, die katholischen Kantone verweigerten dementsprechend einen Zuzug, während Bern und Zürich Truppen entsandten. Doch der Feldzug endete nach der Plünderung Bormios, wo die Reformierten Rache für den Veltliner Mord nahmen, in der Niederlage von Tirano am 11. September 1620.
Am 6. Februar 1621 schlossen Abgeordnete des mehrheitlich katholischen Grauen Bundes in Mailand einen Separatfrieden mit Spanien. Dieser sah zwar die Rückgabe von Veltin und Bormio an die Drei Bünde vor, gab Madrid aber freies Durchzugs- und Besatzungsrecht, auch für die Bündner Pässe. Am 25. Februar 1621 wurde Pompejus Planta, der Führer der spanischen Partei, ermordet, spanische und österreichische Truppen standen im Lande.
In den Mailänder Verträgen vom Januar 1622 mussten die Drei Bünde gegen einen Jahrestribut von 25.000 Gulden auf das Münstertal, das Unterengadin, Davos, Schanfigg, Belfort und das Prättigau verzichten, die wieder zu habsburgischen Untertanen wurden; außerdem mussten sie auf Veltlin und Bormio verzichten. Die Drei Bünde waren zu einem österreichischen Protektorat geworden, nur der Graue Bund konnte sich mit Unterstützung der katholischen Kantone eine gewisse Selbstständigkeit bewahren.
Am 5. April 1622 erhoben sich im Prättigau die Bauern gegen Österreich und vertrieben dessen Truppen und die Kapuziner aus dem Tal. Sie wurden von Venedig, Zürich und Glarus finanziell unterstützt. Nach einer gewaltsamen Intervention von Rudolf von Salis konnten auch die anderen beiden Bünde dazu bewegt werden, den Mailänder Vertrag aufzukündigen und am 14./27. Juni in Chur den gemeinsamen Bund neu zu beschwören. Der Bundestag ernannte Rudolf von Salis zum „Dreibündegeneral“. Salis musste sich jedoch schrittweise bis nach Malans vor den Österreichern zurückziehen. Er deckte die Flucht der Prättigauer Bevölkerung in die Eidgenossenschaft. Wie im Unterengadin, so gingen auch im Prättigau sämtliche Dörfer im Zug der österreichischen Eroberung in Flammen auf. Nachfolgende Epidemien trafen die Bevölkerung wie die Eroberer, die mehrere Tausend Mann verloren; es folgte der Hungerwinter in Graubünden 1622/23. Die siegreichen Österreicher diktierten den Bündnern am 30. September 1622 den Lindauer Vertrag, der im Wesentlichen den Mailänder Vertrag wieder in Kraft setzte und die Grundlage für die Gegenreformation in Graubünden darstellte. Viele traten nach dem Vorbild von Rudolf von Planta zum Katholizismus über.
Frankreich fühlte sich durch die spanisch-habsburgischen Erfolge bedroht und griff zugunsten Bündens ein. Am 17. Februar 1623 schloss Paris mit Savoyen und Venedig ein Bündnis zur Befreiung Graubündens. Spanische und österreichische Truppen erreichten das Veltlin zu spät, als dass sie gegen die vereinigten Kräfte Frankreichs, der Drei Bünde, der Eidgenossenschaft und Venedigs etwas hätten ausrichten können. Das Tal sollte vorläufig durch päpstliche Truppen gesichert und damit im Konflikt zwischen Frankreich und Spanien neutralisiert werde. Und es erhielt durch den Vertrag von Monzòn politische Eigenständigkeit unter nomineller Bündner Oberhoheit. Im Februar 1627 zogen sich die Franzosen zurück und päpstliche Truppen besetzten das Veltlin.
Als Ferdinand II. in Schwaben und im Fricktal ein Heer zur Unterstützung Spaniens im Krieg um Mantua zusammenzog und das Fürstbistum Basel besetzte, vereinigten sich die protestantischen Kantone in einem Verteidigungsbündnis. Die österreichischen Truppen brachten die Beulenpest nach Graubünden, die in den betroffenen Gebieten bis zu zwei Drittel der Bevölkerung tötete. Der Krieg in Italien verlief eher zugunsten Frankreichs. Auch die eidgenössischen Stände Zürich, Bern, Basel, Glarus, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell entsandten Truppen gegen Spanien. Die französischen Interessen wurden von Herzog Henri II. de Rohan vertreten, der als Feldherr der Hugenotten bekannt war. Wegen seines Glaubens und seines geschickten Vorgehens erreichte er Ende Dezember 1631, dass ihm die Drei Bünde den Oberbefehl über ihre Truppen übertrugen. Die Drei Bünde wurden nun faktisch ein französisches Protektorat.
Fünf französische Armeen zogen 1635 gegen den Kaiser ins Feld, eine davon führte der Herzog von Rohan nach Graubünden, um das Veltlin zu erobern und die Verbindung zwischen Österreich und Mailand zu unterbrechen. Er zog durch das Gebiet der reformierten Kantone nach Graubünden und traf am 12. März 1635 in Chur ein, besiegte die Österreicher zwei mal. Im Januar 1636 stellte Rohan den Bündnern in den Clevener Artikeln eine teilweise Wiederherstellung ihrer Hoheitsrechte in den Untertanengebieten in Aussicht, verbot jedoch zugleich die Ausübung des reformierten Glaubens in den Untertanengebieten. Damit entfremdete sich Rohan die Bündner endgültig. Rohan unterlag und musste die Untertanenländer Veltlin, Bormio und Chiavenna den Bündnern zurückgeben und im Mai 1636 abziehen.
Am 3. September 1639 wurde in Mailand ein Übereinkommen beschworen, das so genannte Mailänder Kapitulat, in dem die Untertanengebiete an die Drei Bünde zurückgegeben wurden. Nur die reformierte Bevölkerung von Chiavenna erhielt ein Bleiberecht. Die Inquisition erhielt zudem keinen Zugang in die Bündner Gebiete. Madrid erhielt die Erlaubnis Söldner anzuwerben und das Nutzungsrecht für die Straßen und Pässe, die allen Feinden Spaniens verschlossen blieben. Madrid gewährte seinerseits für den Kriegsfall militärische Hilfe. Zudem wurden Studienplätze für Bündner an den Universitäten Mailand und Pavia sowie zollfreie Kornmärkte am Comersee gewährt.
In zwei Verträgen mit Wien (1649 und 1652) wurden dessen Rechte im Zehngerichtebund, im Münstertal und im Unterengadin mit Krediten der reformierten Orte abgelöst. Ungelöste Konflikte um sich überlagernde Rechte im Münstertal und Vinschgau führten jedoch zu Grenzstreitigkeiten zwischen den Bünden und Österreich, die erst 1762 mit dem endgültigen Verlust aller Bündner Rechte im Vinschgau und der Abtretung des Dorfes Taufers an Österreich zu einem Ende kamen.
Exemtion aus dem Heiligen Römischen Reich (1648), Bauernkrieg (1653)
Im Westfälischen Frieden vom 24. Oktober 1648 erreichten die Schweizer Kantone durch ihren Vertreter Johann Rudolf Wettstein ihre Exemtion, ein reichsrechtliches Privileg mit dem ein Reichsstand seine unmittelbare Unterstellung unter Kaiser und Reich verlor und damit seinen Gerichten nicht mehr unterstellt war. Die Interpretation und die Folgen dieser Maßnahme waren bereits unter den Zeitgenossen umstritten, wurden aber im 18. Jahrhundert nach der sich verbreitenden französischen Souveränitätslehre allgemein als Ausgliederung aus dem Heiligen Römischen Reich verstanden und überwiegend als Anerkennung der völkerrechtlichen Souveränität interpretiert. Seither betrachteten sich alle eidgenössischen Orte als souveräne Staaten. Die staats- und völkerrechtliche Stellung der Eidgenossenschaft wurde folglich als souveräne, neutrale Republik beschrieben.82

Die starke Aristokratisierung der Stadtorte im Zuge der Zentralisierung der Landesherrschaften, die absolutistische Tendenz der Herrschaftsausübung und die Wirtschaftskrise, die in der Schweiz auf den Boom des langen Krieges folgte, bewirkten eine erhebliche Unzufriedenheit in den Untertanengebieten im Mittelland, besonders unter den Bauern. 1653 kam es deshalb im Herrschaftsgebiet der Städte Bern, Luzern, Solothurn und Basel zum Schweizer Bauernkrieg.
Die Aufständischen, die zunächst nur eine Steuererhöhung abgelehnt hatten, belagerten Bern und Luzern, woraufhin die Städte mit Bauernführer Niklaus Leuenberger (ca. 1611–1653) einen Friedensvertrag abschlossen, den Murifeldvertrag. Als das Bauernheer sich zurückzog, entsandte die Tagsatzung von Zürich aus eine Armee, um den Aufstand niederzuschlagen. Nach der Schlacht bei Wohlenschwil am 3. Juni 1653 wurde der Huttwiler Bauernbund gemäß dem Frieden von Mellingen aufgelöst. Der letzte Widerstand im Entlebuch hielt sich bis Ende Juni. Die Städte gingen brutal gegen die Aufständischen vor, Bern erklärte den Murifeldvertrag für ungültig. Bald nach dem Krieg kam es zu einer Reihe von Reformen und Steuersenkungen, womit die Obrigkeit den ursprünglichen Forderungen der Aufständischen entgegenkam.
Der Krieg bewirkte insgesamt eine Stärkung der aristokratischen Tendenzen und eine Vergrößerung der Kluft zwischen Stadt und Land. Zahlreiche Bauern wanderten nach dem Bauernkrieg in das vom Dreißigjährigen Krieg in vielen Teilen entvölkerte Deutschland aus.
Vormachtstellung der katholischen Innerschweiz, französische Dominanz, Parität (1656-1712)
Bereits wenige Jahre nach dem Bauernkrieg bewirkte das Projekt einer Bundesreform 1655 das Wiederaufbrechen der religiösen Zwiste. Im Ersten Villmergerkrieg 1656 versuchten Bern und Zürich vergeblich, den Zweiten Kappeler Landfrieden gewaltsam zu ihren Gunsten zu verändern. Der Sieg der katholischen Orte in der Ersten Schlacht von Villmergen am 24. Januar 1656 bestätigte erneut die Schlechterstellung der Reformierten in den Gemeinen Herrschaften. Während der Schlacht zeigte sich zudem, dass die Bauern im Heer, bedingt durch die brutale Unterdrückung des Aufstandes von 1653, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit nicht motiviert waren, für die Sache der reformierten Städte und ihres Patriziats einzutreten.
Das Bildungswesen wurde zum großen Teil den Jesuiten anvertraut, wogegen die Volksseelsorge in erster Linie bei den Kapuzinern lag. Als Mittel der religiös-sittlichen Unterweisung dienten dabei vorrangig die neu eingeführten Katechismen. Seinen religiös-kulturellen Ausdruck fand der Katholizismus zunehmend in einer die Sinne ansprechenden, stark jesuitisch geprägten Volksfrömmigkeit. Es kam zu einer Blüte zahlreicher Bruderschaften, von Prozessionen und Wallfahrten, sei es zu den Klöstern von Einsiedeln und Mariastein oder zur Wallfahrtskirche von Madonna del Sasso oberhalb von Locarno, die bis heute ihre Bedeutung bewahren konnten, aber auch der Reliquien-, Marien- und Heiligenverehrung, auch neuer Heiliger, wie Franz Xaver. Auch wurde das jesuitische Theater eingesetzt sowie der Bau imposanter Kunst- und Bauwerke des Barock vorangetrieben.
Von der Alpensüdseite zogen Baumeister in die katholischen Kulturzentren und stießen dort eine neue Architektur an, wie in Rom, Florenz, Neapel oder Venedig. Nach dem Dreißigjährigen Krieg trugen die Graubündner Baumeister erheblich zur Verbreitung der neuen Formen auch nördlich der Alpen bei. Mitglieder der Familien Albertalli, Barbieri, Bonalini, Gabrieli, Riva, Serro und Zuccalli aus Roveredo, der Angelini und Viscardi aus San Vittore dominierten die Großbaustellen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. In Graubünden entstanden die vorbildhaften Wandpfeilerkirchen Madonna Maria del Ponte Chiuso, die 1658 geweiht wurde, in Roveredo oder Santa Domenica in Santa Domenica in Calanca (heute Gemeinde Rossa), die 1664-72 entstand.
Die innere Schwäche und Zerstrittenheit der Eidgenossenschaft stellte das Soldbündnis mit Frankreich aber nicht in Frage, das auch mit Ludwig XIV. durch alle Orte und Zugewandte erneuert wurde. Die Eidgenossen erlaubten fortan die Anwerbung von bis zu 16.000 Söldnern, wogegen sie Handelsvergünstigungen und regelmäßige hohe Geldzahlungen, sogenannte „Pensionen“, erhielten.
Später wurde Frankreich auch zum Schiedsrichter für innere Konflikte der Eidgenossenschaft erklärt und erhielt freies Durchmarschrecht durch die Schweiz. Die Eidgenossenschaft wurde durch die engen Verbindungen mit Frankreich faktisch zu einem Protektorat. Trotzdem fanden nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 etwa 60.000 Hugenotten in der reformierten Schweiz Aufnahme. Dieser Zustrom bewirkte in den Städten und im Jura eine starke Belebung der Textil- und Uhrenindustrie.
Dieser wirtschaftliche Aufschwung ließ auf die Dauer den militärischen Vorteil der Länderorte schwinden, weshalb 1712 im Zweiten Villmergerkrieg, der durch religiöse Spannungen in der Fürstabtei St. Gallen ausgelöst wurde, die reformierten Städte die Oberhand behielten. Dies war nur deshalb möglich, weil die wichtigsten katholischen Mächte in den sehr viel bedeutenderen Spanischen Erbfolgekrieg verwickelt waren, der von 1701 bis 1714 andauerte. In dem nach der Zweiten Schlacht von Villmergen geschlossenen Frieden von Aarau vom 11. August 1712 verloren die katholischen Orte ihren Einfluss in den Gemeinen Herrschaften Baden, Freie Ämter, Rapperswil. Zudem mussten sie Bern in die Verwaltung der Herrschaften Thurgau, Rheintal und Sargans aufnehmen. Das Prinzip der Parität, also der Gleichberechtigung beider Konfessionen in den Gemeinen Herrschaften beendete die katholische Vormachtstellung in der Eidgenossenschaft.
Glaubensflüchtlinge, Hugenotten (ab 1685), Ausweisung (1699)
Trotz der internen Spannungen kamen viele Glaubensflüchtlinge in die Eidgenossenschaft. Jeder Schwenk in der französischen Konfessionspolitik vertrieb Glaubensgruppen.83 Menschen aus Lucca, Genua, Cremona und Mailand flohen vor der 1542 wieder eingeführten Inquisition in die Schweiz. Dann suchten Reformierte aus Spanien, darunter Marcos Pérez und der Bibelübersetzer Casiodoro de Reyna, in Basel Zuflucht. Nach dem Erlass des Augsburger Interims von 1548 gingen Deutsche auf Berner Gebiet über, angelsächsische Gemeinschaften entstanden in Genf durch John Knox sowie in Aarau und Vevey während der Herrschaft der katholischen Königin von Schottland Maria Tudor (1553-58).
Unter dem Einfluss Calvins nahm Genf zwischen 1549 und 1587 etwa 8000 Flüchtlinge als Habitanten auf, davon 3000 dauerhaft. Die Berner veranlassten die Waadtländer Gemeinden zur Öffnung des Bürgerrechts und gewährten ihnen Stipendien an der Akademie Lausanne. Nach Zürich kamen Flüchtlinge aus Veltlin und Graubünden, zu denen Reformierte aus Locarno hinzukamen.
Die mächtigen Zünfte bekämpften die Aufnahmepolitik, weil sie die Konkurrenz der hugenottischen Unternehmer im Textilsektor fürchteten. In Basel wichen die Flüchtlinge auf Tätigkeiten aus, die die Alteingesessenen nicht ausübten, etwa in der Seidenweberei oder im Großhandel.
Die Politik Ludwigs XIV. löste erneute Flüchtlingswellen aus, die Aufhebung des Edikts von Nantes am 18. Oktober 1685 zwang 150.000 Hugenotten, Frankreich zu verlassen. Etwa 60.000 von ihnen durchquerten die Schweiz. 1687, auf dem Höhepunkt des Zustroms, kamen Waldenser aus dem Piemont und 1703 etwa 3000 Flüchtlinge aus dem von Ludwig XIV. besetzten Fürstentum Orange.84 Das permanente Einsickern von Flüchtlingen endete wohl erst 1787 mit dem Toleranzedikt Ludwigs XVI.
Angesichts der Widerrufung des Edikts von Nantes einigten sich die Eidgenossen auf einen Verteilschlüssel, nach dem Bern die Hälfte der Flüchtlinge aufnehmen sollte, Zürich 30 %, Basel 12 und Schaffhausen 8 %. Es entstanden eigene Institutionen, wie die Exulantenkammern. Anders als in Ländern wie Brandenburg wurde die Anlage von entsprechenden Kolonien abgelehnt, weil dies die Wirtschaftslage am Ende des 17. Jahrhunderts nicht zuließ. Zudem bestand die Gefahr, dass die katholischen Orte brüskiert oder Frankreich, das besonders auf Genf Druck ausübte, herausgefordert wurde. Nachdem die reformierten Orte im September 1693 an der Tagsatzung in Baden die „Wegweisungspolitik“ festgelegt hatten, musste die Mehrheit der Flüchtlinge die Schweiz im Frühling 1699 in Richtung Deutschland verlassen (Grand départ).
Etwa 20.000 Hugenotten ließen sich dauerhaft in der Schweiz nieder. Ihre Manufakturbetriebe entsprachen merkantilistischen Wirtschaftsvorstellungen und schufen Arbeitsplätze. Zudem siedelten sich die meisten Hugenotten im noch wenig industrialisierten Kanton Bern an.
Rasch schufen die Hugenotten die Rahmenbedingungen für ein Gemeinschaftsleben, indem sie u.a. nach dem Vorbild der Konsistorien Hilfsfonds für ihre Bedürftigen einrichteten, bourses françaises genannt. Sie boten Überbrückungshilfe und Versorgung im Krankheitsfalle. Die Hilfsfonds von Genf und Basel waren schon im 16. Jahrhundert gegründet worden. An einigen Orten blieben die bourses bis ins 19. Jahrhundert bestehen, die von Yverdon sogar bis vor wenigen Jahren. Die Lausanner bourse, die sowohl die Nachkommen der Hugenotten als auch die Neuankömmlinge des 18. Jahrhunderts aufnahm, zählte um 1750 rund 1700 Mitglieder, während die Stadt 8000 Einwohner hatte.
Die Flüchtlinge führten in der Textilindustrie eine frühkapitalistische Organisation ein und bauten internationale Netzwerke auf, wofür beispielsweise die Karriere des aus Lucca geflohenen Francesco Turrettini an der Spitze der Grande Boutique der Genfer Seidenindustrie steht. Die Schweizer Indienneindustrie (Zeugdruck) verdankte ihren Erfolg vor allem Netzwerken von Schweizer Bankiers hugenottischer Herkunft, die durch Eheverbindungen noch verstärkt wurden. Zudem erhöhten die „Refugianten“ die Nachfrage nach Luxusgütern.
Die Hugenotten trugen darüber hinaus zur Verbreitung der französischen Kultur bei, die im 16. und 17. Jahrhundert eine Blütezeit erlebte. Streng kontrolliert von der lokalen Pfarrerschaft, entstanden in Aarau, St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur und Zürich neue Französische Kirchen. Die Kleidermode des Pariser Adels, Cafés und Boutiquen breiteten sich besonders in der Westschweiz aus; es entstanden Zeitungen und Zeitschriften, darunter die Bibliothèque italique. Im 18. Jahrhundert vertraten ihre Gelehrten ein rationales und liberales Christentum und stellten ein Viertel der Pfarrer in Genf.
Johann Kaspar Mörikofers Geschichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz von 1876 verklärte die Glaubensflüchtlinge, wie es für die Historiografie der Zeit typisch war. Die Hilfsbereitschaft der Aufnahmeländer und der Beitrag der Flüchtlinge zu deren Entwicklung standen dabei im Vordergrund. Walter Bodmer war einer derjenigen, die diese Mystifikation beseitigten, die bis heute nachwirkt. Er stieß auf asylpolitische Maßnahmen, die überdeutlich von wirtschaftlichen Überlegungen bestimmt waren. Damit legte er den Grundstein für spätere Studien, die durch die Gedenkfeiern zum 300. Jahrestag der Widerrufung des Edikts von Nantes angeregt wurden. In deren Gefolge wurde 1986 die Schweizerische Gesellschaft für Hugenottengeschichte gegründet, die eine Quellen- und Studiensammlung herausgibt.
Ancien Régime, Zurichtung auf den Markt, Zünfte (1712–1798)
Im 18. Jahrhundert glich die Alte Eidgenossenschaft angesichts der in Europa vorherrschenden mehr oder minder absolutistischen Monarchien einem Überbleibsel aus dem Spätmittelalter, war sie doch keineswegs ein Staat im modernen Sinne. Vielmehr bestand sie aus einem Geflecht souveräner Kleinstaaten, die sich in einem Staatenbund zusammengeschlossen hatten. Dabei waren aber nicht alle Gebiete der Schweiz gleichermaßen in diesen Bund eingeschlossen. Den Kern bildeten die Dreizehn Alten Orte, die entweder Stadt- oder Landorte waren. Als Stadtorte oder Stadtrepubliken galten Zürich, Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Basel, während Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Ob- und Nidwalden sowie Appenzell Inner- und Ausserrhoden zu den „Ländern“ gezählt wurden. Hinzu kamen die Untertanengebiete, die den vollberechtigten Orten unterstanden und in denen ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung lebte. Sie unterstanden entweder direkt einem der Dreizehn Orte oder wurden als gemeine Herrschaften durch mehrere Orte verwaltet. Bis auf die Appenzeller Orte verfügten alle vollberechtigten Orte über solche Untertanengebiete, wobei die wichtigsten mehrheitlich den Stadtorten angehörten.
So geboten allein Bern und Zürich über etwa zwei Fünftel der Schweizer Bevölkerung. Neben den dreizehn Orten und ihren Untertanengebieten gab es auch noch die Zugewandten Orte St. Gallen, Graubünden und Wallis, die in einem lockeren Verhältnis zum Kern standen. Als einzige gemeinsame Institution des Bündnisgeflechts fungierte die Tagsatzung, in der die vollberechtigten Orte mit je zwei und die zugewandten Orte mit je einem Gesandten vertreten waren. Ihre wichtigsten Aufgaben waren die Verwaltung der gemeinsamen Herrschaften, die Außenpolitik und die Verteidigung, ihre Macht war jedoch sehr beschränkt und die Entscheidungsfindung bei Abstimmungen, die Einstimmigkeit erforderte, gelang eher selten.


Die Stärkung der Staatsgewalt nach dem französischen Vorbild des Absolutismus brachte drei Verfassungstypen hervor, die aristokratische Formen und Gottesgnadentum mit den republikanischen Traditionen vereinten. In Bern, Solothurn, Freiburg und Luzern herrschte das Patriziat, das Regiment weniger alteingesessener Familien. Die Zunftaristokratie in Zürich, Basel und Schaffhausen begrenzte die Oligarchie der Alteingesessenen durch den Einfluss der Zünfte und in den Landsgemeindeorten entwickelte sich eine gemeinsame Aristokratie des alten Landadels und der durch den Solddienst zu Reichtum und Adelsprädikaten gekommenen Familien.
Die neuen Tendenzen in der Herrschaftsausübung bewirkten im 18. Jahrhundert eine ganze Reihe von Aufständen in den betroffenen Untertanengebieten, die jedoch bis 1798 allesamt mit äußerster Härte niedergeschlagen wurden. Dies hing weniger mit absolutistischen Vorstellungen zusammen, als mit den geradezu totalitaristischen Vorstellungen, mit denen zunächst die städtische Gesellschaft, dann aber auch die ländlichen Gesellschaften überzogen wurden. Darüber hinaus war es vor allem für die katholischen Landbewohner eine Abwendung von einem gottgefälligen Leben zu einem Leben, in dessen Mittelpunkt Arbeit und vor allem Gelderwerb standen. So begannen die Obrigkeiten Prozessionen und Feiertage so zu legen, dass die Zahl der arbeitsfreien Tage, wie im Falle Freiburgs ab 1781, auf 22 reduziert wurde. Schon seit 1775 durften Wallfahrten nur noch innerhalb der Gemeindegrenzen durchgeführt werden. Damit hatten die städtischen Eliten den Kampf um die wahre Frömmigkeit eröffnet, ihre Untertanen sprachen ihnen zunehmend den Charakter einer guten christlichen Obrigkeit ab, sie hielten die neue Politik für gotteslästerlich. Anfang Mai 1781 versammelten sich Tausende Bewaffnete vor der Stadt, ihr Anführer Pierre Nicolas Chenaux forderte den Rat ultimativ auf, die Abschaffung der Feiertage und das Wallfahrtsverbot zurückzunehmen. Das katholische Freiburg musste die Hilfe des reformierten Bern in Anspruch nehmen, ein gewaltiger Gesichtsverlust. Doch auch die Landbevölkerung, die bisher nach rückwärts geschaut hatte, und dementsprechend nur die Wiederherstellung alter Zustände gefordert hatte, wandte den Blick auf neue Ziele, die dem alten System sehr viel gefährlicher wurden. Sie gingen bald auch über die Ziele individuellen Ehrgeizes weit hinaus. Der Impuls dazu kam von außen, aus Paris.
Doch die Züricher Obrigkeit beachtete diese Umwälzung ab 1789 kaum. Auch die Zünfte fürchteten die wachsende ländliche Konkurrenz und sträubten sich gegen jede Änderung. Besonders im Berner Waadtland fühlten sich die ländlichen Honoratioren durch die Aristokraten Berns zurückgesetzt und entmündigt. Männer wie der junge, hochgebildete Aristokrat Frédéric César de Laharpe (1754-1838), der es in Russland zum Erzieher des zukünftigen Zaren Alexander gebracht hatte, fühlten sich in ihrer Heimat von den alteingesessenen Aristokraten behindert. Dabei war der Widerhall im Ländlichen sehr unterschiedlich. Die katholischen Gebiete lehnten den französischen Jakobinismus schon wegen seiner antiklerikalen Haltung ab.
Aufklärung
Das Zeitalter der Aufklärung folgte auf die Epoche des Konfessionalismus und der Orthodoxie. Albrecht von Haller und Jean-Jacques Rousseau lösten durch ihre Verherrlichung der Natürlichkeit, Einfachheit und Unverdorbenheit der Eidgenossenschaft eine regelrechte Schweizbegeisterung und eine erste Welle des Tourismus aus. Mit seiner Staatstheorie leistete Rousseau zudem einen wichtigen Beitrag zur späteren Entstehung der direkten Demokratie. Zürich wurde gleichzeitig durch eine Ansammlung europaweit bekannter Gelehrter, etwa Johann Jakob Bodmer, Salomon Gessner, Johann Heinrich Pestalozzi und Johann Caspar Lavater, zum „Athen an der Limmat“. Der Einzug von Vernunft und Planung brachte neben der Verbesserung von Infrastruktur und Wirtschaft auch eine Lockerung der strengen religiösen Zucht in den reformierten Orten und eine Wiederannäherung der Konfessionen im Zeichen gegenseitiger Toleranz.86
Die zeitgenössischen Dichter und Gelehrten ließen durch ihre Verteidigung der bestehenden oder imaginierten Eigenarten ein Schweizer Nationalbewusstsein entstehen. 1761/62 manifestierten sich diese patriotischen und aufklärerischen Strömungen in der Gründung der Helvetischen Gesellschaft die sich für Freiheit, Toleranz, die Überwindung der Standesunterschiede und die patriotische Verbundenheit der Eidgenossen einsetzte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entdeckte die Literatur auch das Motiv der gemeinsamen heldenhaften Vergangenheit vor Marignano, die seither als „Schlachtengeschichte“ bis ins späte 20. Jahrhundert das Geschichtsbild der Schweiz bestimmte. Durch den Rückbezug auf die gemeinsame idealisierte Vergangenheit konnte so die Auseinandersetzung mit der schwierigen Zeit der konfessionellen Spannungen vermieden werden.
An die Stelle der durch Dogmen bestimmten Denkkategorien trat die Überzeugung, dass die autonome menschliche Vernunft als letzte Entscheidungsinstanz über Wahrheit und Irrtum zu befinden habe. Alle bisherigen Erkenntnisse waren darum rationaler Kritik zu unterwerfen. Die Aufklärung forderte die Freiheit der Meinungsäußerung und Toleranz.
Von England, den Niederlanden und Frankreich her kommend erreichte sie die Schweiz relativ spät, zuerst gegen Ende des 17. Jahrhunderts die reformierten Landesteile. 1712 standen die reformierten Vororte Zürich und Bern gegen die fünf katholischen Orte der Innerschweiz letztmals in einem Konfessionskrieg, der mit einem Sieg der Reformierten endete. Dieser Sieg war zugleich ein Sieg der aufgeklärten Mentalität und der wirtschaftlich übermächtigen Gebiete, wenn auch ausländische Universitäten, reformierte Geistliche und Gelehrtenzirkel die Aufklärung in die Schweiz trugen. Die Universität Basel, die einzige Universität in der Schweiz, diente hingegen fast nur noch der engeren Region.
Erstmals in Genf unteerrichtete mit dem Theologen Jean-Alphonse Turrettini ab 1697 als Professor in entsprechender Geisteshaltung, Jean-Frédéric Ostervald und Samuel Werenfels führten diesen Richtungswechsl in Neuenburg und in Basel an (Helvetisches Triumvirat). Innerhalb des Protestantismus erfolgte ein Abbau der konfessionellen Schranken, eine Abkehr von einem allzu harten Puritanismus. Ab den 1730er Jahren gelangte diese Haltung nach Zürich und in die reformierte Ostschweit, in Bern vollbrachten dies vor allem Albrecht von Haller und die Brüder Niklaus Emanuel von Tscharner und Vinzenz Bernhard von Tscharner.
Man entkleidete die Offenbarung aller irrationalen Züge und begnügte sich mit einfachen, der Natur entsprechenden Lehrsätzen. Die Lebensführung hatte der Lehre zu entsprechen. Nach und nach begegneten auch die „vernünftigen Orthodoxen“ den Pietisten mit mehr Toleranz. Dennoch wurden drei Geistliche in Basel, Neuenburg und Zürich wegen zu freigeistiger Meinungen des Landes verwiesen.
Parallel dazu vollzog sich in der Rechts- und Staatslehre die Rezeption des neuen Naturrechts. Mit diesem beschäftigte sich vorerst einmal die welsche Naturrechtsschule von Jean Barbeyrac in Lausanne, Jean-Jacques Burlamaqui in Genf und Emer de Vattel in Neuenburg. Ihr System basierte auf dem „gesunden Menschenverstand“, postulierte unverletzliche Rechte und die Freiheit des Gewissens. Sollten dem Menschen elementare Rechte genommen werden, so hatte er ein Recht auf Widerstand gegen die Tyrannis. Das Naturrecht galt für den Einzelnen wie für den Staat. Handelte der Mensch gemäß dem Naturrecht, so wurde er glücklich, die Glückseligkeit aber war das Ziel der Existenz.
Mit der Republik beschäftigte sich auch Isaak Iselin und Johann Georg Zimmermann in seinem Von dem Nationalstolze von 1758. Es ging ihnen um die Freiheit der Meinungen, um die bürgerlichen Tugenden und um den Einsatz des Bürgers für die Werte der Republik.
An die Stelle der Berufung auf die aristotelischen Kategorien trat die Beweiskraft der mathematischen Evidenz und des Experiments. Bahnbrechend waren hier die Basler Brüder Johann und Jacob Bernoulli sowie dessen Nachkommen. Erst nach Widerständen, besonders gegen die Einführung des kopernikanischen Weltbilds, drang der aufklärerische Geist durch. Die Wunder der Natur ließen sich im reformierten Klima neben die biblischen Wunder stellen, ohne dass man in Konflikt mit der Kirche geriet, wie in den katholischen Gebieten. In diesem Sinne arbeitete etwa der Genfer Naturforscher Charles Bonnet.
Im 18. Jahrhundert entstand mit der Hochgebirgsforschung und der Alpengeologie eine besondere Aufgabe der Schweizer, in Zürich gepflegt durch Johann Jakob Scheuchzer, in Genf durch Horace Bénédict de Saussure.
Der Berner Beat Ludwig von Muralt gab in seinen Briefen über die Engländer und Franzosen von 1725 der freien englischen Welt des common sense gegen die artifizielle Welt Frankreichs den Vorzug. Die Krönung dieser Entwicklung bildete der Versuch Schweiz. Gedichte des Jahres 1732 von Albrecht von Haller. Zürich wurde durch Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger zu einem neuen Zentrum der deutschen Literatur. Die Schriftsteller der modernen Richtung, wie Wieland und Klopstock, schlugen sich auf die Seite der „Zürcher“.
Für Johann Jakob Bodmer und seine Schüler war die Geschichte der Schweizer die „Lobrede“ eines ganzen Volkes, ein Sonderfall. Er schuf Mythen, die bis heute fortwirken, wie die Rechtmäßigkeit ihrer Kriege, die Heiligkeit der Gesetze, der Verzicht auf territoriale Ausdehnung, die Tapferkeit und der Patriotismus ihrer Bürger und der demokratische Ursprung ihrer Verfassungen. Isaak Iselin betrachtete die Geschichte der Menschheit als fortschreitende Bewegung von den primitiven Anfängen auf das humanitäre Ziel hin.
Jean-Jacques Rousseau trat zunächst mit einer vernichtenden Kulturkritik auf, trat aber später für einen gemäßigten demokratischen Republikanismus ein. Er übertrug das Genfer Modell auf Europa, das er sich als eine föderalistische Organisation vorstellte. Der mündige Bürger sollte sich freiwillig der volonté générale unterziehen, und durch die Bindung aller an das Gesetz sollte eine höhere Stufe von Freiheit und Gleichheit erklommen werden.
Johann Georg Zimmermann entwickelte eine psychologische Analyse des Individuums in seiner Freiheit und Unabhängigkeit, d.h. in seiner inneren Glückseligkeit. Johann Georg Sulzer beschäftigte sich mit der Kindererziehung und forderte - lange vor Rousseau - deren Natürlichkeit.
Bei der Bildung setzte Johann Heinrich Pestalozzis Reformbewegung ein, die das 19. Jahrhundert prägte. Frauen hatten hingegen keinen Anspruch auf Bildung, doch brachten in der Schweiz verheiratete Ausländerinnen nebst Schweizerinnen in literarisch-philosophischen Zirkeln (z.B. Julie Bondeli in Bern) eine verfeinerte Geselligkeit hervor. Deren Salons spielten für die Verbreitung von Ideen eine erhebliche Rolle. Zudem entstanden literarisch-neusprachlich orientierte Mädchenschulen.
Insgesamt sind die Auffassungen der als Helvetismus bezeichneten Variante der Aufklärung durch die christliche Auffassung des Naturrechts, die patriotische Ethik, den Ansatz vom gesunden Menschenverstand her und die enge Verbindung mit ökonomischer und pädagogischer Praxis gekennzeichnet.
Eine der bedeutenden Zeitschriften war der Mercure suisse (1732-84), eine Summa gab die Encyclopédie d'Yverdon (1770-80) wieder, die sich als Alternative zur französischen Encyclopédie verstand. Die Sozietäten, getragen von der sozialen Elite des ganzen Landes, dienten praktischen, gemeinnützigen oder wirtschaftlichen Zwecken. Lesegesellschaften verbreiteten literarische Bildung, ökonomische Gesellschaften kümmerten sich um die Verbesserung agrarischer oder industrieller Methoden. Zudem wurde die Ausbildung fachspezifischer und differenzierter.
Bemerkenswert ist die kurzlebige Société des citoyens in Bern: Sie verstand sich als Patriotische Gesellschaft zur Förderung aufklärerischen Gedankenguts. Die Naturforschenden Gesellschaften befassten sich nicht nur mit den Problemen der Praxis, sondern ebenso sehr mit der Naturphilosophie. Die nachhaltigste aufklärerische Organisation war die Freimaurerei. Logen entstanden 1736 in Genf, 1739 in Lausanne und 1740 in Zürich, doch erst 1768 in Basel.
Der Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche und der Offenbarung sowie die Religion als solche wurden von den Aufklärern der katholischen Schweiz nie angezweifelt. Erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts prägte, v.a. in Luzern und Solothurn aufklärerischer Patriotismus das Denken (Joseph Anton Felix von Balthasar, Josef Rudolf Valentin Meyer von Schauensee, Karl Müller-Friedberg) und des Weltklerus (Bernhard Ludwig Göldlin, Franz Philipp Gugger). Trotz der Ablehnung geistlicher Herrschaft und des klösterlichen Lebens zeigten sich die Benediktiner und Zisterzienser in der Regel der Aufklärung gegenüber aufgeschlossener als die Bettelorden. So gingen von Schweizer Klöstern (St. Urban) und Weltgeistlichen wichtige Impulse zur Verbesserung des lokalen Unterrichtswesens, der Mädchen- und der Lehrerbildung aus, ebenso wie in diesen Kreisen historisch-quellenkritische und naturwissenschaftliche Forschungen betrieben wurden.
Zusammen mit weltlichen Patrioten wandten sich katholische Geistliche gegen die römische Suprematie und dessen Zentralismus. So setzten sie sich gegen die Luzerner Nuntiatur, vorerst mit geringem Erfolg, u.a. für die Wessenbergschen Reformen in Liturgie, Seelsorge und kirchlichem Unterricht ein. Der Volksaufklärung stand man, wie die katholische Landbevölkerung insgesamt, ablehnend gegenüber. Erst mit dem Aufkommen des Liberalismus im 19. Jahrhundert entfaltete das Gedankengut der Aufklärung auch hier seine politische Wirkung.
Insgesamt strahlte die Schweizer Aufklärung auf die bedeutenden Höfe Europa aus, wie Berlin oder Petersburg. Die ausgesprochen rationalistisch konzipierte Variante wurde in den 1770er Jahren durch den Sturm und Drang erschüttert. Johannes von Müller legte in seiner Geschiche der Schweizer von 1780 in historistischer Art das Modell einer neuen nationalen Geschichtsschreibung vor.
Doch erst die Helvetische Revolution und die schweren Niederlagen machten 1798 Platz für neue, modernere Formen des Staats. Doch bis 1848 blieb die Schweiz zerrissen zwischen einer föderalistisch-konservativen und einer zentralistisch-fortschrittlichen Parteirichtung.
Republiken, Franzosenzeit: Helvetik und Médiation 1798–1814

Schon im Vorfeld der Französischen Revolution kam es in Genf zu Versuchen, eine Republik zu gründen. 1781 errangen Bürgertum und Arbeiterschaft von Genf die Vorherrschaft, woraufhin eine repräsentativ-demokratische Verfassung angenommen wurde. Doch im Jahr darauf ergriff mit Hilfe bernisch-savoyischer Truppen das Patriziat erneut die Macht und viele Unternehmer mussten emigrieren. Im Februar 1794 kam in Genf, ähnlich wie inzwischen in Frankreich, eine Gruppe von Jakobinern an die Macht. „Konterrevolutionäre“ und „Aristokraten“ wurden hingerichtet. Im März folgte die Revolution im Freistaat der Drei Bünde, doch die Ziele waren zu verschieden. Während den Landbewohnern mehr Einfluss vor Ort und erhöhte Autonomie vorschwebte, ging es den Städtern um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in einer Republik.
Nach dem Tod Robespierres 1794 änderte Frankreich seinen Charakter. Das Direktorium lehnte soziale Experimente ab, die Verfassung von 1795 schützte die Herrschaft der Vermögenden. Um für Ablenkung zu sorgen setzte Paris, nachdem der außenpolitische Druck nachgelassen hatte, auf äußere Expansion. Zunächst war Italien an der Reihe, wo sich Napoleon betätigte und 1797 die Venezianische Republik auslöschte. Mit der Gründung der Cisalpinischen Republik wurde das Regime Napoleons für die Tessiner zunehmend attraktiv. Der Anschluss konnte zu einem Druckmittel werden, endlich ein eigenes Kanton Tessin durchzusetzen, was am Ende auch gelang. Die Schweizer begannen, konservative Emigranten auszuweisen und sie erkannten die Regierung in Paris an. In der Ostschweiz erklärten sich Republiken für unabhängig, doch Freiheitsregungen der Aargauer wurden von Bern militärisch niedergeschlagen.
1798 wurde die Alte Eidgenossenschaft, womit der Franzoseneinfall begann, von Truppen Napoléon Bonapartes besetzt und nach französischem Vorbild ein zentralistischer Einheitsstaat, die Helvetische Republik, gegründet. Solothurn und Freiburg leisteten, im Gegensatz zu Bern, das am 5. März 1798 unterlag, keinen Widerstand. Am 15. April wurde Genf annektiert und war in den Jahren 1799 bis 1804 Teil der Ersten Französischen Republik und bis 1813 als Hauptort des Kantons Genf Teil des Kaiserreichs Napoleons.
Die Kantone wurden in Verwaltungseinheiten umgewandelt und nach dem Vorbild der französischen Départements neu eingeteilt. Während der „Helvetik“ wurden die Kantone Léman, Oberland, Aargau, Waldstätte, Säntis, Linth, Thurgau, Bellinzona, Lugano, Rhätien, Baden und Fricktal neu geschaffen. Genf, Mülhausen und der Jura mit Biel kamen zu Frankreich; Neuenburg blieb preußisch, stand aber in keiner Verbindung mehr mit der Schweiz. Hauptstadt des Einheitsstaates war vorerst Aarau. Die Bürger wurden in einer feierlichen Zeremonie auf die neue Ordnung vereidigt. Wie in Frankreich wurde die katholische Kirche weitgehend enteignet, ihr Besitz zu Nationalgütern erklärt, im Mai 1798 beschlagnahmt und ab September staatlich verwaltet. Eine Ausnahme bildete das Hospiz auf dem Sankt-Bernhard-Pass.
Mitte August 1798 wurden die Repräsentanten des neuen Staates aus Schwyz und Nidwalden vertrieben oder gefangen genommen. Als eine 10.000 Mann starke französische Armee einrückte, unterwarfen sich die Schwyzer, doch in Nidwalden kam es unter Führung des Kapuzinerpaters Paul Styger zum Aufstand, der erst nach dem Tod von fast 500 Einheimischen zusammenbrach. Die Orte Ennetmoos, Stansstad und Buochs wurden zerstört, der Hauptort Stans teilweise. Erst nach der Unterwerfung der Innerschweiz erhoben sich am 17. Mai auch die Walliser vergebens gegen Frankreich. Noch kritischer wurde die Situation, als 1802 die Franzosen nach vier Jahren abzogen, die eine „Tochterrepublik“ gegründet hatten.
Napoleon hatte bereits 1801 den streitenden Parteien in ultimativer Form einen eigenen Verfassungsentwurf aufgedrängt, die Verfassung von Malmaison, die als Kompromiss zwischen Zentralismus und Föderalismus die Errichtung eines Bundesstaates vorgesehen hatte. Zum Missfallen Napoleons ergab sich aus seinem Entwurf aber keine Beruhigung der Lage in der Schweiz, da die Föderalisten und Unitarier fast ein ganzes Jahr um eine Abänderung der Verfassung von Malmaison stritten. Nach dem vierten Staatsstreich vom 17. April 1802 wurde eine in unitarischem Sinn abgeänderte Version des Verfassungsentwurfs ausgearbeitet und durch eine Volksabstimmung in Kraft gesetzt. Napoleon ließ daraufhin seine Truppen aus dem Lande abziehen.
Von August bis Oktober 1802 kam es nach dem Abzug der französischen Truppen zu einem Bürgerkrieg, der als Stecklikrieg bekannt wurde, als ‚Knüppelkrieg‘. Er fand zwischen den Unitariern, die für einen Zentralstaat nach französischem Vorbild eintraten und den Föderalisten statt, die eine Wiederherstellung der alten Kantone und ihrer Privilegien forderten. Dabei besaßen die Unitarier aufgrund der stark verwurzelten föderalen Traditionen wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Der Aufstand, der sich vor allem in der Zentralschweiz, Zürich, Bern, Solothurn und im Aargau ausbreitete, konnte die Regierung infolge des Gefechts beim Renggpass am 28. August 1802, der Beschießungen von Bern und Zürich Mitte September 1802, des Gefechts bei Faoug am 3. Oktober 1802, stürzen. Diese zog sich nach einer militärischen Kapitulation am 18. September 1802 von Bern nach Lausanne zurück. Ihr folgten nur noch die Kantone Waadt und Freiburg. Die Macht übernahmen kantonale Regierungen und eine von Alois von Reding geleitete Tagsatzung in Schwyz. Diesen Zustand beendeten französische Truppen, die - im Sommer 1802 nach vier Jahren abgezogen - im Oktober auf Befehl Napoleons wieder einrückten. Da die französische Intervention eine Verletzung der Bestimmungen des Friedens von Lunéville darstellte, nahm Großbritannien dies zum Anlass, Frankreich am 18. Mai 1803 den Krieg zu erklären.
Dieser gesamteuropäische Zusammenhang berührte die Aufständischen in der Schweiz nur bedingt. Bereits ab dem 19. Februar 1802 kam es im Waadtland zu Unruhen, bei denen Bauern die Archive zahlreicher Gemeinden und ehemaliger Feudalherrschaften verbrannten, um so die Erhebung von Feudalabgaben zu verhindern. Deren Abschaffung war 1798 zugesagt, jedoch 1800 waren sie wieder eingeführt worden, da es keine ausreichenden Mittel der Staatsfinanzierung gab. Der Bodenzinssturm im Kanton Basel im Herbst 1800 war die erste Reaktion gewesen, es folgte ein Aufstand im Waadtland. Die Aufständischen wurden als Bourla-Papey, als ‚Papierverbrenner‘ bekannt. Zwischen Februar und Mai 1802 sammelten sich 2 bis 3000 Waadtländer Bauern und vernichteten die Akten ehemaliger Feudalherrschaften, die Grund- und Bodenrechte beanspruchten. Dem fielen auch die Archive von 132 Gemeinden des Waadtlands, über ein Drittel aller Gemeinden, zum Opfer. Am 8. Mai marschierte Louis Reymond als Commandant an der Spitze von 1500 Bourla-Papeys in Lausanne ein, musste jedoch drei Tage später wieder abziehen. Von August bis Oktober kam es zum besagten Stecklikrieg, der letztlich zum erneuten Einmarsch der Franzosen führte.
Insgesamt kam es zwischen 1799 und 1803 zu vier Staatsstreichen, unter anderem wollte dabei der Waadtländer Frédéric Laharpe – nach Napoleons Vorbild in Frankreich – eine Alleinherrschaft errichten.87
Föderalistische Verfassung (1803), „Schweizerische Eidgenossenschaft“

Erst durch das Eingreifen Napoléons 1803 kam die Schweiz wieder zur Ruhe. Er versammelte die politische Führungsgruppe der Schweiz in Paris an der Helvetischen Consulta und erarbeitete mit ihr die Mediationsakte (Vermittlungsakte), eine neue föderalistische Verfassung, die Napoleon garantierte. Die Selbstständigkeit der Kantone wurde gestärkt, der Einheitsstaat zum Staatenbund. Die „Schweizerische Eidgenossenschaft“, so der nun offizielle Staatsname, zählte gemäß der Mediationsakte 19 Kantone, deren Verfassungen ebenfalls in der Mediationsakte enthalten waren. Die Dreizehn alten Kantone wurden wiederhergestellt, neu waren die Kantone St. Gallen, Aargau, Thurgau, dazu Tessin und Waadt. Das Wallis wurde wegen der strategischen Bedeutung des Simplonpasses für Frankreich zuerst eine unabhängige Republik, die schließlich 1810 zu Frankreich kam. Graubünden mit dem Gebiet der Drei Bünde verlor die alten Untertanengebiete Veltlin, Bormio und Chiavenna an das Königreich Italien. In Graubünden versuchten 26 Gemeinden, ihre alte Souveräntität zurückzugewinnen. Sie besaßen nun einen Großen Rat, dessen Mitglieder, wie überall, von den Franzosen zuvor ausgefiltert wurden, doch konnten sie immerhin gegen seine Entschlüsse das Referendum bemühen. Einige Gemeinden mussten zu dieser Zeit noch gezwungen werden, den 1582 für die katholischen Gebiete durchgesetzten Gregorianischen Kalender anzuerkennen. Dennoch blieb die Religionspolitik restriktiv. Wer nicht zum Gottesdienst erschien konnte öffentlich diffamiert und bestraft werden, Nichtkatholiken konnten ihre politischen Rechte verlieren.

Die Bindung der Schweiz an Frankreich wurde am 27. September 1803 durch den Abschluss einer Militärkapitulation und einer Defensivallianz bekräftigt. Doch die neue Ordnung bedeutete vor allem für die Landschaften der Stadtkantone einen Rückschritt, wenn auch das neue Staatsoberhaupt unter dem Titel Landammann Vertrauen schaffen sollte. Dieer war ein Vertrauter Napoleons. Die Stadtbürger hatten nun wieder ein stärkeres politisches Gewicht. Da gleichzeitig durch das Zensuswahlrecht die Begüterten bevorzugt wurden, hatten diese fast eine Wiederherstellung der aristokratischen Ordnung erreicht. Vom 24. März bis zum 3. April 1804 kam es deshalb im Kanton Zürich in der Gegend von Horgen zu einem Aufstand der Gemeinden am Zürichsee, dem Bockenkrieg. Hauptgrund waren als ungerecht empfundene Loskaufgesetze für Zehnt- und Grundzins. Der Aufstand wurde mit Hilfe der Tagsatzung niedergeschlagen, auf dem Zürichsee kamen bei der Beschießung von Horgen drei Kriegsschiffe zum Einsatz. Die Führer Hans Jakob Willi und zwei weitere Anführer wurden trotz Intervention Napoleons hingerichtet.88 Enttäuscht war auch das alte Patriziat von Bern, denn die Stadt hatte ihre Macht in den einstigen Untertanenstädten verloren, die Patrizier ihr Machtmonopol im Innern.
Das Schulwesen wurde stark ausgebaut. Lehrerseminare und Kantonsschulen werden errichtet. Die Schweizer Pädagogik erlangte Weltruf durch Johann Heinrich Pestalozzi, Philipp Emanuel von Fellenberg, Johann Jacob Wehrli und Jean Baptiste Girard. 1807 wurde die Linthkorrektion als gemeinnütziges Werk begonnen, um die Linthebene von Malaria und Überschwemmungen zu befreien.
1806 gelangte das Fürstentum Neuenburg von Preußen an Napoleon. Eine Integration in die Schweiz scheiterte, da dieser seinen Generalstabschef Marschall Louis-Alexandre Berthier zum Fürsten von Neuenburg erhob. Im Juli 1806 musste die Tagsatzung unter französischem Druck die Einfuhr aller britischen Manufakturwaren verbieten und sich damit der Kontinentalsperre anschließen. 12.000 Söldner sollten stets für den Dienst in Frankreich zur Verfügung gestellt werden. Die Werbung der Truppen blieb der Schweiz überlassen.
Während der Mediation bildete sich ein rudimentäres Nationalbewusstsein heraus. Die alten aristokratisch-patrizischen Familien der Kantone verschmolzen mit den Aufsteigern aus Politik und Wirtschaft. Als Integrationsmoment diente ein übergreifendes Nationalgefühl. Höhepunkte hierin bildeten die Unspunnenfeste 1805 und 1808, wo das Selbstbild eines Volkes von Hirten, des einfachen Berglebens und der Freiheit stilisiert wurde, das bis heute als Ideal hochgehalten wird.
Die Großmächte erzwingen den Fortbestand: der Bundesvertrag von 1815
Bis zur Niederlage Napoleons im Herbst 1813 war die Schweiz ein Vasallenstaat Frankreichs. Schweizerische Truppenverbände und Söldner nahmen deshalb sowohl am Krieg in Spanien als auch am Russlandfeldzug von 1812 teil. Im Dezember 1813 löste sich das von Napoleon geschaffene Staatswesen unter dem Druck der innenpolitischen Gegenrevolution und der anrückenden Truppen der sechsten Koalition wieder auf.
Zwischen den alten und den neuen Kantonen bestanden kurzzeitig beträchtliche Spannungen, die Schweiz stand erneut vor einem Bürgerkrieg. Erst unter äußerem Druck durch die siegreiche Koalition der Großmächte rückten die nur noch lose im Bundesverein von 1813 organisierten souveränen Kantone im Sommer 1814 enger zusammen, so dass am 7. August 1815 mit den neuen Kantonen Genf, Wallis und Neuenburg nunmehr 22 Kantone mit dem sogenannten Bundesvertrag die Schweiz wieder als Staatenbund konstituierten.
Der Landammann Hans von Reinhard verfolgte eine sehr zögerliche Politik und lavierte zwischen Napoleon und der sechsten Koalition. Das eidgenössische Aufgebot zur Grenzbesetzung von 12.500 Mann wurde als dürftig empfunden, eine Loslösung von Frankreich unterblieb, die Schweizerregimenter blieben im französischen Heer.
Der österreichische Außenminister Metternich versuchte vergeblich, durch Agenten und Bestechungszahlungen die Schweiz für die Koalition zu gewinnen. Als eher hinderlich erwies sich auch die Agitation konservativer Aristokraten im Exil, die im Waldshuter Komitee für eine Besetzung der Schweiz durch die Alliierten sowie eine vollständige Wiederherstellung der vorrevolutionären Zustände agierten. Dies bestärkte besonders den Widerstand in den neuen Kantonen, die die Hauptopfer einer solchen Restauration gewesen wären.
Am 21. Dezember 1813 überschritten zwischen Basel und Schaffhausen alliierte Truppen die Grenze auf dem Durchmarsch nach Frankreich, nachdem Basel vor dem österreichischen General Karl Philipp zu Schwarzenberg kampflos kapituliert hatte. Die Schweizer Grenztruppen zogen sich kampflos zurück. Wie zuvor die französischen Truppen hielten sich auch die alliierten durch Requisitionen und Einquartierungen auf schweizerischem Gebiet schadlos. Die Präsenz der alliierten Truppen und die Agitation des österreichischen Agenten führte in Bern am 23./24. Dezember zur Abdankung der Mediationsregierung und zur Wiedereinsetzung der vorrevolutionären Regierung. Bern rief darauf Waadt und Aargau zur sofortigen Unterwerfung auf und drohte mit der Anwendung von Waffengewalt.


Am 29. Dezember beschlossen zehn alte Kantone in Zürich die Aufhebung der Mediationsverfassung. Sie erneuerten das alte Bundesverhältnis und bildeten den Bundesverein. Da sie die Abschaffung der Untertanenverhältnisse bekräftigten, schlossen sich die neuen Kantone mit der Ausnahme von Graubünden dem Bundesverein an. In der Folge kam es im Januar zu patrizisch-aristokratischen Gegenrevolutionen in Freiburg, Solothurn und Luzern. Die Schweiz zerfiel in zwei Lager: Freiburg, Solothurn, Luzern, Zug, die drei Waldstätte und Bern betrieben die völlige Wiederherstellung der Alten Eidgenossenschaft und versammelten sich zur Gegentagsatzung in Luzern. Graubünden versuchte sich als unabhängiger Freistaat zu etablieren und die Untertanengebiete im Veltlin zurückzuerhalten. In Zürich versuchte der Bundesverein unter der Führung von Hans von Reinhard, die Grenzen und Verhältnisse der Mediationszeit zu retten.
Im März drohte der Konflikt in einen Bürgerkrieg auszuarten. Bern, Waadt und Aargau mobilisierten Truppen, die ausländischen Mächte nahmen indirekt auf der Seite der einen oder anderen Seite teil. Entscheidend war der Einfluss des waadtländischen Patrioten Frédéric-César de la Harpe auf den russischen Zaren Alexander zugunsten der neuen Kantone. Erst auf die Drohung einer militärischen Intervention durch die Alliierten schloss sich die Gegentagsatzung am 6. April 1814 dem Bundesverein an und bildete die „Lange Tagsatzung“. Durch die Annahme eines neuen Bundesvertrags am 9. September 1814 bzw. dessen Beeidigung am 7. August 1815 endete die Mediationszeit, und es begann die Epoche der Restauration in der Schweiz.
Die Schweiz als Staatenbund, Sonderbundskrieg (1815–1847)
1815 wurden am Wiener Kongress die weitgehend bis heute bestehenden Binnen- und Außengrenzen der Eidgenossenschaft anerkannt. Genf, Neuenburg und das Wallis wurden nun zu Vollkantonen. Bern erhielt als Entschädigung für die Verluste der Waadt und des Aargau die Gebiete des ehemaligen Fürstbistums Basel im Jura einschließlich der Stadt Biel. Der nördliche, katholische Teil dieses Gebietes bildet heute den Kanton Jura. Die Erwerbung weiterer Gebiete für die Schweiz, etwa des Umlands von Genf, der Stadt Konstanz oder des Veltlins, scheiterte jedoch. Um das strategisch wichtige Alpengebiet aus dem Einflussbereich Frankreichs zu lösen, bekräftigten die Großmächte die «immer währende bewaffnete Neutralität» der Eidgenossenschaft.
Im Innern wurde die Eidgenossenschaft während der Restaurationszeit durch den Bundesvertrag von 1815 zusammengehalten, der eine sehr weitgehende Selbstständigkeit der Kantone gestattete. Die Kriegs-, Münz- und Zollhoheit wurde wieder den Kantonen übertragen. Als Zentralinstanz fungierte wieder die Tagsatzung, die sich in jährlichem Turnus in den drei Vororten Zürich, Bern oder Luzern versammelte. Als einzige ständige Institution existierte eine eidgenössische Kanzlei, die mit der Tagsatzung jährlich in die Vororte umzog.
In den Kantonen des Mittellands mündete die Phase der Restauration in die liberale Regeneration von 1830/31: Die aristokratischen Systeme wurden endgültig gebrochen und durch liberal-demokratische ersetzt. Allerdings ergaben sich während einer Übergangsphase erneut innerkantonale Spannungen, allerdings kämpften hier Liberale gegen Katholisch-Konservative oder dann Altliberale, also Anhänger der repräsentativen Demokratie mit Zensuswahlrecht, gegen Demokraten, Anhänger der direkten Demokratie mit allgemeinem gleichem Wahlrecht.
Auf Grund einer fortwährenden Polarisierung zwischen liberalen (mehrheitlich städtisch-reformierten) und konservativen (mehrheitlich ländlich-katholischen) Kantonen nach den Freischarenzügen schlossen sich die katholischen Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis 1845 zu einem Sonderbund zusammen. Die liberale Mehrheit der Tagsatzung erzwang noch im November 1847 durch General Henri Dufour dessen Auflösung. Der Sonderbundskrieg war der letzte bewaffnete Konflikt auf dem Gebiet der Schweiz.
Sobald die Existenz und der Inhalt des geheim gehaltenen Bündnisses bekannt wurde, beantragte Zürich im Sommer 1846, den Sonderbund gemäß dem Bundesvertrag für aufgelöst zu erklären. Der Antrag erhielt aber erst die erforderliche Mehrheit der Stimmen der Kantone, nachdem im Juli 1847 in Genf und St. Gallen die liberale Partei an die Macht gekommen war. Zusätzlich wurde eine Revision des Bundesvertrages und die Ausweisung des Jesuitenordens aus der Schweiz beschlossen. Da die sieben Sonderbundskantone, auf die katholischen Mächte Österreich und Frankreich vertrauend, unzugänglich blieben, entschied sich die Tagsatzung am 4. November 1847 zur Anwendung von Gewalt.
Der offene Krieg begann durch den Einfall der Sonderbundstruppen am 3. November 1847 ins Tessin, am 12. November folgte ein Vorstoß ins aargauische Freiamt. Doch im Tessin kehrten die Truppen nach dem Tod ihrer führenden Offiziere um und im Freiamt trafen die Sonderbundstruppen beim Gefecht von Geltwil und beim Gefecht bei Lunnern auf Verbände der eidgenössischen Armee – beide Treffen endeten ohne Sieg.

Die eidgenössische Armee von fast 100.000 Mann unter General Guillaume-Henri Dufour rückte ab dem 11. November gegen die Sonderbundskantone vor. Die Kantone Appenzell Innerrhoden und Neuenburg erklärten ihre Neutralität und schickten keine Truppen. Zuerst musste am 14. November das vom restlichen Sonderbund isolierte Freiburg kapitulieren. Während die Operation gegen Luzern vorbereitet wurde, kam die Meldung, dass am 17. November eine Kolonne der Sonderbundstruppen den Sankt Gotthard überquert und eidgenössische Truppen im Tessin bei einem Gefecht bei Airolo in die Flucht geschlagen hatte.
Am 22. November begann der Angriff auf Luzern. Während dieser Auseinandersetzungen achtete Dufour streng auf die Einhaltung humanitärer Grundsätze bei den Kampfhandlungen. Die von Johann-Ulrich von Salis-Soglio befehligten Truppen des Sonderbundes wurden am 23. November bei Gisikon, Meierskappel und Schüpfheim geschlagen, worauf Luzern am 24. November kapitulierte. Die Stadt wurde besetzt. Die übrigen Innerschweizer Kantone des Sonderbunds beschlossen am 25. November in Brunnen ebenfalls die Kapitulation. Als letzter Kanton ergab sich am 29. November das Wallis.
Die Verfassungen und Regierungen in den besiegten Kantonen wurden in liberalem Sinne revidiert. Außerdem mussten die Verlierer die Kriegskosten durch Reparationszahlungen begleichen. Die in Luzern wieder an die Macht gelangten Liberalen lösten zur Schuldentilgung weitere Klöster im Kanton auf. In einer gemeinsamen Note erklärten Österreich, Preußen, Frankreich und Russland am 18. Januar 1848, dass sie keine Veränderung der Bundesakte von 1815 zulassen würden, die mit der Souveränität der Kantone in Widerspruch stehe. Die von den Siegern beherrschte Tagsatzung wies diese Einmischung zurück. Aufgrund der angespannten innenpolitischen Lage in Frankreich (Februarrevolution) und in Deutschland (Märzrevolution) blieben Konsequenzen aus.
Emanzipation der Juden
Kampf um die Gleichstellung (bis 1879), Freizügigkeit (1866), Religionsfreiheit (1874)
1798 wandten sich die Surbtaler Juden mit der Bitte um Gleichberechtigung an die Regierung. Das Parlament lehnte diese jedoch ab und stellte die Juden sogar schlechter als Fremde, da nur für die Juden das Datum der letzten Schutzbrieferteilung (1792) als Ausgangspunkt für eine zwanzigjährige Wartefrist zur Einbürgerung galt. Immerhin wurden am 4. Juni 1798 die diskrimierenden Sonderabgaben als Verstoß gegen die Menschenrechte abgeschafft.89 Im September 1802 kam es im sogenannten Zwetschgenkrieg zu schweren Ausschreitungen gegen die Surbtaler Juden, denen man unterstellte, von der Helvetik profitiert zu haben.90

Infolge der Annexion Genfs durch Frankreich galt dort - wie im früheren Fürstbistum Basel - bis 1814 die Gleichberechtigung, wie sie in Frankreich durchgesetzt war. In den Städten Basel und Bern konnten sich zu Anfang des neuen Jahrhunderts einzelne jüdische Familien niederlassen, in Avenches entstand nach 1826 eine neue Landgemeinde mit fast 200 Angehörigen. Auf Ersuchen der Schweizer Diplomaten hatte Frankreich jedoch 1826 zugestimmt, die eigenen jüdischen Staatsbürger von einem Freizügigkeitsübereinkommen auszuschließen. Die Folge war, dass sich Juden nur mittels individueller Privilegien in der Schweiz niederlassen, die ländlichen Juden überhaupt nicht umziehen durften. Trotzdem entstanden zwischen 1830 und 1848 weitere Gemeinden in La Chaux-de-Fonds, Delsberg und Biel. Die frankophonen Behörden waren den Juden gegenüber freundlicher gesinnt als die deutschsprachigen.
1831 nahmen die Aargauer Juden unter Führung von Markus Getsch Dreifuss erneut den Kampf um die Gleichberechtigung auf, doch ohne Erfolg. Selbst die neue Bundesverfassung von 1848 schloss die Juden von der Freizügigkeit aus. Erst 1856 stellte ein Bundesbeschluss die Gleichheit bezüglich Kauf und Verkauf, vor Gericht sowie im Stimm- und Wahlrecht auf der Ebene der Eidgenossenschaft und der Einzelkantone her, nicht aber auf lokaler Ebene. Frankreich und die Niederlande machten 1863 den Abschluss von Handels- und Niederlassungsverträgen von der Gewährung der vollen Niederlassungsfreiheit für Juden abhängig, und auch die USA übten Druck aus. 1866 erhielten die Juden die Freizügigkeit, 1874 auch das Recht der freien Religionsausübung.
Im Aargau initiierte der katholische Publizist Johann Nepomuk Schleuniger eine judenfeindliche Volksbewegung, die mit der Abberufung des Parlaments, dem Rücktritt der Regierung und der Rücknahme des Gesetzes endete. Hier mussten die Juden von Endingen und Lengnau noch fast zwei Jahrzehnte warten, bis ihnen 1879 die Ortsbürgerrechte, allerdings in separaten jüdischen Institutionen, zugebilligt wurden.
Im Aargau kam es 1855-66 sowie 1886-88 zu Konflikten wegen des Schächtens, ebenso in St. Gallen 1874-75. 1893 wurde es verboten. Hingegen berief die Universität Bern bereits 1836 den Breslauer Juden Gabriel Gustav Valentin zum Ordinarius und 1864 wurde Moritz Lazarus in Bern und Max Büdinger in Zürich Rektor bzw. Dekan. Neue Gemeinden entstanden durch die Zuwanderung vom Lande, Synagogen entstanden in Genf 1856, Avenches 1865, Basel 1868 und Pruntrut 1874. Akademisch gebildete Rabbiner wurden berufen, zuerst in Genf mit dem Philologen Joseph Wertheimer.
Erste Auseinandersetzungen um die Modernisierung des Judentums nach deutschem Vorbild hatte schon Rabbiner Meyer Kayserling, der im Surbtal von 1861 bis 1870 wirkte, und Markus Getsch Dreifuss provoziert. Die Gemeinden westlich der Linie Basel-Liestal-Luzern waren elsässisch geprägt, die jenigen an Marktorten im Aargau und in Luzern gingen auf die Surbtaler Juden zurück.
Jüdische Gründerzeit (1866-1933)
1918 gab es in der Schweiz 25 Gemeinden und seit 1904 einen Dachverband, den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund. Die meisten der heutigen Synagogen wurden vor 1914 im historisierenden maurischen Stil erbaut, wie etwa 1881 in St. Gallen, 1883 in Zürich, 1906 in Bern.
Durch Zuwanderung zuerst aus dem Elsass, Südbaden und Vorarlberg, dann aus Deutschland und aus Osteuropa wuchs die jüdische Bevölkerung der Schweiz von 3.000 im Jahr 1850 auf 21.000 im Jahr 1920. Zugleich wurde aus dem Land- ein Stadtjudentum. 1910 lebten bereits 55 % von ihnen in Zürich, Basel oder Genf. Sie hatten einen großen Anteil an der Entwicklung der Textil- und Stickereiindustrie, im Neuenburger und Berner Jura sowie in Biel waren sie an der Entfaltung der Uhrenindustrie beteiligt. Um 1930 wurden viele Warenhäuser von Juden gegründet (Maus und Nordmann oder auch Loeb), ebenso wie Privatbanken (Julius Bär).

Etwa 4.000 jüdische Flüchtlinge aus Russland kamen in die Schweiz. Sie brachten religiöse Traditionen und Bräuche mit, die von den ortsansässigen Juden vielfach abgelehnt wurden. Deren Integration in den Alltag führte vielfach zu einer weitgehenden Assimilation, einer Integration unter Aufgabe des Bezugs zum Judentum. Andererseits wurden rund zwei Drittel der Zionistenkongresse zwischen 1897 und dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz abgehalten, internationale Versammlungen einer Bewegung, die sich die Auswanderung nach Palästina zum Ziel gesetzt hatte.
Der Bundesstaat
Gründung


Durch den Sieg der liberalen Kantone wurde der Weg für eine stärkere Zentralisierung des bisherigen Staatenbundes frei, die mit der ersten Bundesverfassung am 12. September 1848 umgesetzt wurde. Damit konstituierte sich die Schweiz als parlamentarischer Bundesstaat. Ein Wesensmerkmal der neuen Verfassung war die Vereinheitlichung vom Maß- und Münzwesen sowie die Abschaffung der Binnenzölle. Die Bundesverfassung wurde seither nur zweimal, 1874 und 1999, umfassend überarbeitet („Totalrevision“).
Außenpolitische Konflikte mit Preußen und Frankreich, Verbot des Söldnertums
Die Absetzbewegungen in Neuenburg vom Königreich Preußen bedeuteten 1857 für den jungen Bundesstaat eine erste außenpolitische Herausforderung. Während unter General Dufour die Mobilmachung anlief, gelang es im letzten Moment, den Neuenburgerhandel diplomatisch zu regeln. Weitere Grenzbesetzungen erfolgten während der österreichisch-italienischen Kriege 1859 und 1866. Die Kontroverse um die Rolle der Schweizer Söldner in Italien führte 1859 zum Verbot des traditionellen „Reislaufens“.
1860 verursachte die Abtretung Savoyens durch Sardinien-Piemont an Frankreich eine weitere Krise, da nationalistisch gesinnte Kreise unter Führung von Bundesrat Jakob Stämpfli das Recht der Schweiz ausüben wollten, Chablais, Faucigny und Teile des Genevois zu besetzen. Ein Plebiszit in Savoyen ergab jedoch eine eindeutige Mehrheit für den Anschluss an Frankreich. Der Savoyerhandel, bei dem es um die Region südlich des Genfersees mit etwa 275.000 Einwohnern ging und die dem heutigen französischen Département Haute-Savoie entspricht, wurde durch die Einrichtung einer Freizone um Genf beigelegt.
1870/71 führte der Deutsch-Französische Krieg zu einer Grenzbesetzung unter General Hans Herzog. Im Februar 1871 überquerten unter den Augen der Schweizer Armee etwa 87.000 Mann der geschlagenen französischen Bourbaki-Armee in den Kantonen Neuenburg und Waadt die Grenze und wurden interniert.
Einführung der Volksinitiative (1869), Kulturkampf (ab 1873) und Kultusfreiheit, Zivilehe (bis 1874)
Die Auseinandersetzungen zwischen Radikalen und Konservativen dauerten nach 1848 auf Kantonsebene weiter an. Ab 1863 kämpfte dann zusätzlich eine neue Demokratische Bewegung für den Übergang von der repräsentativen zur direkten Demokratie und für wirtschaftlich-soziale Reformen. Die Demokraten erhielten durch die als Folge der Industrialisierung gravierender werdende soziale Frage Auftrieb, weshalb der 1838 gegründete Arbeiterbildungsverein Grütli, der 1890 immerhin 16.000 Mitglieder zählte, sowie linke Idealisten die radikal-demokratischen Forderungen unterstützten. Obwohl einzelne Kantone Schutzbestimmungen für Fabrikarbeiter und Kinder erließen (Glarner Fabrikgesetz von 1864), blieben die Probleme der Arbeiterschaft bestehen. Schrittweise erkämpften die Demokraten Verfassungsrevisionen in den Kantonen, die z. B. in Zürich 1869 die Einführung der Volksinitiative, des obligatorischen Gesetzesreferendums sowie die Volkswahl der Regierung beinhalteten. Nach einem ersten gescheiterten Versuch 1872 wurde deshalb 1874 auch die Bundesverfassung im Sinne der Demokraten revidiert. Die neue Verfassung enthielt neben dem Ausbau der direkten Demokratie auch eine Zentralisierung des Kriegswesens sowie eine allgemeine Rechtsvereinheitlichung.
1873 brach auch in der Schweiz wegen des Unfehlbarkeitsdogmas des Ersten Vatikanischen Konzils der Kulturkampf zwischen dem Staat und der katholischen Kirche aus. Es ging primär um den Einfluss der Kirche im neuen liberal-säkularen Staatswesen. Ein kleinerer Teil der römisch-katholischen Gläubigen spaltete sich zur neuen Christkatholischen Kirche ab, die 1877 immerhin 46.600 Mitglieder zählte. Heute gehören ihr mehr als 13.000 Mitglieder an. Starke Spannungen zwischen der römisch-katholischen Kirche und den liberalen Kantonen gab es im Bereich des Bistums Basel, besonders im vom reformierten Bern beherrschten katholischen Nord-Jura. Der Kulturkampf fand seinen Niederschlag in der Bundesverfassung von 1874, zum Beispiel im Verbot des Jesuitenordens, in der Einführung der Zivilehe und der Gewährung der vollen Glaubens- und Kultusfreiheit.
Arbeiterbewegung, Entstehung des heutigen Parteienspektrums, Integration der Katholiken
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Konfliktlinien zwischen Liberalen und Konservativen durch das Aufkommen der Arbeiterbewegung aufgeweicht. 1888 schlossen sich kantonale Arbeiterparteien zur Sozialistischen Partei (SP) zusammen, der heutigen Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Nur wenige Jahre später vereinigten sich auch die konservativen und liberal-demokratischen Bewegungen auf nationaler Ebene in Parteien: 1894 wurden die Freisinnig-Demokratische Partei (FdP) und die Konservativ-Katholische Partei (KK), die heutige Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) gegründet. Dominiert wurde die Bundespolitik mit deutlichen Mehrheiten von den Gründern des liberaldemokratischen Staatswesens, von den Freisinnigen.
1891 wählte die Bundesversammlung den Luzerner Joseph Zemp als ersten Katholiken und Vertreter des gemäßigten Flügels der katholisch-konservativen Bewegung in den Bundesrat. Damit begann die Integration der 1848 und 1874 unterlegenen konservativ-katholischen Kräfte in den Bundesstaat.
Eisenbahnbau, Industrialisierung, Staatsbetriebe, Zuwanderung
Am 9. August 1847 wurde im Zuge der allgemeinen Industrialisierung des Landes zwischen Zürich und Baden die erste ausschließlich in der Schweiz verkehrende Eisenbahnlinie eröffnet, die im Volksmund den Namen „Spanisch-Brötli-Bahn“ erhielt. Einige Jahre zuvor war Basel bereits durch eine französische Bahnlinie mit Straßburg verbunden worden. Der Ausbau des Bahnnetzes erfolgte vorerst durch private Bahngesellschaften. Nach politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen um den Bahnbau gerieten viele Eisenbahngesellschaften in den 1870er Jahren in eine Krise. Trotzdem gelang 1882 die Eröffnung der Gotthardbahn mit finanzieller Hilfe Deutschlands und Italiens. Nach 1898 wurden die Bahnen schrittweise bis 1909 verstaatlicht und in die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) überführt. Bereits 1848 war die Schweizerische Post gegründet worden.
In wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung des Mittellandes und eine starke Zunahme der Bevölkerung geprägt. Von 1850 bis 1900 stieg die Bevölkerung von knapp 2,4 Millionen auf über 3,3 Millionen, trotz einer erheblichen Auswanderung, die allerdings weit hinter der Italiens lag. Zwischen 1851 und 1860 wanderten rund 50.000 Schweizer nach Übersee aus, in den 1860er- und 1870er-Jahren je 35.000 und zwischen 1881 und 1890 über 90.000. Bis 1930 stabilisierte sich die Zahl der Auswanderer pro Jahrzehnt zwischen 40 und 50.000. Der wohl bekannteste Auswanderer war Johann August Sutter. Der als General Sutter bekanntgewordene kalifornische Ländereienbesitzer gründete die Privatkolonie Neu-Helvetien. Auf seinem Land begann 1848 der kalifornische Goldrausch.
Die Schweiz wurde vom Agrarland zum Industriestaat. Führend war bis zum Ersten Weltkrieg die Textilindustrie in der Ostschweiz. In ihrem Gefolge entwickelten sich die Maschinenindustrie und vor allem in Basel die chemische Industrie. Nach dem Aufkommen der Elektroindustrie entstand zwischen Rheinfelden AG und Rheinfelden (Baden) das erste große europäische Flusskraftwerk, das Alte Wasserkraftwerk Rheinfelden. Bald folgten zahlreiche Wasserkraftwerke zur Erzeugung von Elektrizität für die Textil- und die Aluminiumindustrie, später auch für die Privathaushalte und die Bahnen.
In der Landwirtschaft wurde der Getreideanbau wegen der billigeren Importe immer mehr zugunsten der Milch- und Viehwirtschaft aufgegeben. Käse und Milchprodukte sowie Schokolade wurden zu wichtigen Exportgütern.
Wegen der industriellen Umbrüche sahen sich viele Menschen marginalisiert und abgedrängt und durch die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse zur Auswanderung nach Nord- und Südamerika sowie nach Russland gezwungen, aber auch innerhalb Europas. In Norddeutschland kam die Bezeichnung „Schweizer“ für die auf Bauernhöfen eingesetzten Melker auf. Die Landflucht bewirkte ein starkes Wachstum der Städte, so dass der prozentuale Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung zwischen 1850 und 1920 von 6,4 auf 27,6 % anstieg.91 Gleichzeitig kam es, bedingt durch kulturelle und Abstiegsängste um die Jahrhundertwende zu reflexhaften Formen des Widerstands gegen die Zuwanderung, die als Konkurrenz wahrgenommen wurde. 1893 kam es in Bern zu den „Käfigturmkrawallen“ , die sich beide gegen die italienischen Zuwanderer richteten, ebenso wie 1896 in Zürich die „Italienerkrawalle“.
Rotes Kreuz (1863)
Auf Initiative des Genfers Henry Dunant (1828–1910) erfolgte 1863 in Genf die Gründung des späteren Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Durch die Genfer Konvention, der bis 1868 alle europäischen Staaten beitraten, wurde das Rote Kreuz als Hilfsdienst des Heeres anerkannt und der Sanitätsdienst neutralisiert. Als Sitz des Roten Kreuzes wurde Genf zur Metropole mit internationaler Ausstrahlung. Dieses Zentrum zog weitere wichtige internationale Organisationen an, die wiederum zum heutigen Nimbus der Schweiz erheblich beitragen.
Die beiden Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, Kampf um Gesellschaftssysteme, Rassismus (1914-1945)
Erster Weltkrieg: drohende Spaltung, „bewaffnete Neutralität“, ideologische Kämpfe, Kriegsproduktion vs. humanitäre Dienste

Der Forschungsstand zur Geschichte des Ersten Weltkriegs in der Schweiz ist ausgesprochen unbefriedigend. Während dieser beinahe viereinhalb Kriegsjahre bewahrte die Schweiz die „bewaffnete Neutralität“, geradezu eine Insellage, an die noch heute die meisten Schweizer glauben. Doch die Auswirkungen auf die Schweiz waren gravierend. So drohte dem Land die Spaltung angesichts der Orientierung der beiden Sprachgruppen, der französischen und der deutschen, an den beiden Kriegsgegnern, deren Führer ein Millionenheer opferten. Aber auch innenpolitisch und auf der gesellschaftlichen und sozialen, auch der kulturellen Ebene kam es zu weitreichenden Veränderungen.
Am 1. August 1914 wurden durch den Bundesrat 220.000 Soldaten mobilisiert. Die Truppen wurden von General Ulrich Wille geführt, der sich in enem zeifelhalften Verfahren gegen Theophil Sprecher von Bernegg durchsetzte, der seinerseits Generalstabschef wurde. Wille forderte später den Eintritt der Schweiz in den Krieg auf Seiten der Mittelmächte. Zunächst erfolgte jedoch die Grenzbesetzung. Der Schlieffen-Plan Berlins sah schon vor dem Krieg vor, Frankreich über Belgien und nicht etwa über die Schweiz hinweg anzugreifen, um nach Paris zu gelangen. Obwohl französische und italienische Pläne bestanden, die Mittelmächte mittels Durchmarsch durch die Schweiz zu attackieren, blieb die Schweiz von militärischen Übergriffen auf ihr Territorium verschont. Jedoch kam es zu einem ungeheuren Zentralisierungs- und Bürokratisierungsschub, der dennoch weder den Graben zwischen der französischen pro-alliierten, und der deutschen, partiell auf Seiten der Mittelmächte stehenden Schweiz überbrücken, noch die Verarmung erheblicher Teile der Bevölkerung verhindern konnte.
Gefährlich für das Fortbestehen der Schweiz war dementsprechend die politische und kulturelle Spaltung des Landes entlang der Konfliktlinien deutsch-welsch (Röstigraben) bzw. bürgerlich-sozialistisch. Teile der Deutschschweizer Bevölkerung sympathisierten mit den Mittelmächten (vor allem mit Deutschland), während in der Westschweiz Frankreich unterstützt wurde. Besonders die deutschschweizerische Militärelite um General Wille und Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg stand nach der Obersten-Affäre in der Westschweiz unter Verdacht, mit Deutschland bzw. Österreich-Ungarn zu paktieren. Dabei hatten Friedrich Moritz von Wattenwyl und Karl Egli, zwei Oberste im Generalstab, die Militärattachés Deutschlands und Österreich-Ungarns mit den Tagesbulletins des Schweizer Generalstabs und mit verschiedenen Telegrammen unterschiedlicher Bedeutung und Vertraulichkeit versorgt, die der Schweizer Nachrichtendienst entschlüsselt hatte.
1917 unternahm Bundesrat Arthur Hoffmann den Versuch, einen Frieden zwischen Russland und Deutschland zu vermitteln. Hoffmann musste auf Druck der Entente zurücktreten, weil ihm vorgeworfen wurde, Deutschland zu einer Entlastung an der Ostfront verhelfen zu wollen.
Während des ganzen Krieges bot die Schweiz humanitäre Dienste an, das Angebot von Erholungsaufenthalten für Verwundete in Kurorten, bei der Heimschaffung Zivilinternierter beider Seiten oder der Organisation des-Austauschs von Verwundeten.
Wirtschaftlich bedeutete der Weltkrieg eine enorme Belastung. Die stark steigenden Ausgaben des Bundes ließen die Schulden anwachsen, so dass 1915 eine einmalige Kriegssteuer und 1916 eine Kriegsgewinnsteuer eingeführt wurden. Um die Versorgung des Landes mit Kohle, Lebensmitteln und Stahl sicherzustellen, willigte der Bundesrat in eine Überwachung des Außenhandels durch die Kriegsparteien ein und gewährte ihnen Kredite. Trotzdem machte die Versorgungskrise 1917 die Rationierung der wichtigsten Nahrungsmittel und Energieträger nötig.

Die politischen Parteien willigten am Anfang des Krieges im August 1914 in einen „Burgfrieden“ ein, so dass die Parteistreitigkeiten ruhten. Nach den internationalen sozialistischen Konferenzen von Zimmerwald (1915) und Kiental (1916) im Kanton Bern wuchs jedoch innerhalb der SP der Einfluss der antimilitaristischen und revolutionär orientierten Kräfte stark an. 1917 beschloss die SP ein entsprechendes Parteiprogramm, das einen Bruch mit der restlichen Parteienlandschaft signalisierte. Die sich verschärfenden sozialen Probleme stärkten die Sozialisten, besonders in den Städten. Ab November 1917 entluden sich die Spannungen in Form von Unruhen, Streiks und Demonstrationen. Der Landesstreik vom November 1918 gilt als Höhepunkt der politischen Konfrontation zwischen dem Bürgerblock, den traditionellen liberalen und konservativen Kräften und der Arbeiterbewegung. Ausgerufen vom Oltener Aktionskomitee wurde er von der Armee nach einem Ultimatum des Bundesrates unterdrückt.
Angesichts des Rüstungswettlaufs und des ungeheuren Ressourcenverbrauches zwischen den Kriegsgegnern entstanden Widersprüche zwischen der propagierten Neutralität, den Aktivitäten des von Genf aus operierenden Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, der Anteilnahme der Bevölkerung an den Kriegsereignissen im Ausland und der umfassenden Kriegsgüterproduktion. Zwischen 1914 und 1917 lebte zudem der nachmalige russische Revolutionsführer Lenin als Flüchtling in der Schweiz.
Zwischenkriegszeit: Vorarlberg sucht Anschluss, Sozialisten und Bürgerblock
Nach dem Ende des Krieges versuchte das österreichische Bundesland Vorarlberg, einen Anschluss an die Schweiz zu erreichen. In den Pariser Vorortverträgen wurde die Neutralität der Schweiz erneut bestätigt, Vorarlberg jedoch Österreich zugeteilt sowie die Neutralisierung Hochsavoyens aufgehoben. 1920 trat die Schweiz nach einer Volksabstimmung dem Völkerbund bei, der seinen Sitz in Genf hatte. Damit begann eine Phase der differenzierten Neutralität der Schweiz, das hieß, dass sie zwar an wirtschaftlichen, nicht aber an militärischen Sanktionen des Völkerbundes teilnahm.
1919 setzte der bürgerliche Bundesrat Reformen um, die weitgehend die Forderungen der Arbeiterbewegung erfüllten, zum Beispiel die Einführung der 48-Stundenwoche. Im Oktober 1919 wurde der Nationalrat erstmals im Proporzwahlrecht bestimmt, was ein Ende der Dominanz des Freisinns und einen starken Aufschwung für die Sozialisten bedeutete. Dessen ungeachtet beschloss die SP Ende des Jahres ein Parteiprogramm, das durch seine antimilitaristische Stoßrichtung und durch die Ablehnung der Demokratie, die Partei in eine klare Opposition zur bürgerlich-demokratischen Staatsordnung setzte. Trotzdem kam es zur Abspaltung radikaler Sozialisten in der Kommunistischen Partei der Schweiz. Die bürgerlichen Parteien bildeten als Reaktion den Bürgerblock, der während der Zwischenkriegszeit die Regierung stellte und die SP auf Bundesebene politisch isolierte. Die Innenpolitik der Zwischenkriegszeit wurde durch die wachsenden Gegensätze zwischen Bauern und Gewerbetreibenden einerseits und den Angestellten bzw. den diese vertretenden Parteien und Organisationen geprägt. Als neue bürgerliche Kraft wurde 1918 im Kanton Bern von dem Bauernführer Rudolf Minger die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) gegründet. Sie stand ursprünglich als zentristische Bauernpartei in Opposition zu den bürgerlichen wie auch sozialistischen Parteien, wurde aber dennoch bald in den Bürgerblock integriert und erhielt mit der Wahl Mingers in den Bundesrat 1929 einen Regierungssitz.
Weltwirtschaftskrise (ab 1930/31), Politik gegen Minderheiten, Bund gegen Faschismus (1936)
Nach dem Kriegsende kam es in der Schweiz zu einer ersten Wirtschaftskrise, die besonders die Ostschweiz traf, wo die Textilindustrie wegen der fehlenden ausländischen Nachfrage nach Luxusprodukten zusammenbrach. Nach der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland 1923/24 erholte sich die Wirtschaft zwar wieder, wurde aber im Laufe der Jahre 1930/31 ebenfalls in den Sog der Weltwirtschaftskrise gerissen. Der Zusammenbruch des Exports auf fast ein Drittel führte zu einem starken Preisverfall und Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die öffentliche Hand versuchte auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene durch Notarbeiten, Großprojekte und verschiedene andere wirtschaftspolitische Eingriffe vergeblich ein Ende der Krise herbeizuführen. Die staatliche Preis- und Lohnsenkungspolitik verstärkte durch ihre deflationäre Wirkung die Krise sogar noch. In der Arbeiterschaft kam es zu einer ausgeprägten Radikalisierung. Am 9. November 1932 kamen bei der militärischen Niederschlagung von Arbeiterprotesten gegen den Faschismus in Genf dreizehn Arbeiter ums Leben.92
Im Rahmen des Kampfes gegen das „Landstreichertum“ wurde 1926 das Hilfswerk Kinder der Landstrasse der Pro Juventute gegründet, um jenische Kinder ihren Eltern zu entziehen - eine Politik, wie sie in vielen Staaten gegenüber ihren nicht sesshaften Minderheiten geübt wurde und wird. Merkmale dieser historischen Jenischen waren ihr ökonomischer, rechtlicher und sozialer Ausschluss aus der Mehrheitsbevölkerung und - möglicherweise jedoch nur bei einer Minderheit - eine dadurch bedingte Dauermigration. Die Jenischen führen sich auf mittelalterliche, vagierende Gruppen zurück, die bis heute nicht Romanes, sondern eine eigene Sprache sprechen. Ziel der Politik war die erzwungene Integration der Jenischen. Ab 1972 wurde die Praxis auf Druck der Medien vom Bund aufgearbeitet. Zwischen 1926 und 1973 wurden 586 Kinder ihren Eltern weggenommen und zwangsweise in andere Familien verbracht. Ein weiteres düsteres Kapitel in der Geschichte der Schweiz des frühen 20. Jahrhunderts war der Umgang mit sogenannten Verdingkindern. Kinder aus armen oder sozial schwierigen Verhältnissen wurden durch die Vormundschaftsbehörden meist an Bauern vermittelt, die die Kinder häufig als günstige Arbeitskräfte ausnutzten und misshandelten. Die zuständigen Behörden griffen kaum ein. Die Praxis wurde erst in den 1970er Jahren aufgegeben. Beim Umgang mit den „Zigeunern“ lassen sich vier Phasen erkennen. Ab 1848 wurden Erfassung und Einbürgerung sowie Versuche der Sesshaftmachung vorangetrieben. Zwischen 1906 und 1972 bestand ein Einreiseverbot für ausländische „Zigeuner“, dann folgte die Phase der besagten Kinderwegnahme, schließlich seit 1998 die Anerkennung als ethnische Minderheit, was ihre Sprache einschloss. Während Roma-Verbände schon durch ihren Namen eine unangemessene Vereinheitlichung der höchst verschiedenen Gruppen vorantreiben, wehren sich andere gegen diese erneuten Fremdzuweisungen und die damit verbundenen Stereotype, die sozialwissenschaftlichen und historischen Untersuchungen widersprechen. Allerdings besteht sowohl bei der Erforschung des „Antiziganismus“, als auch bei der Erforschung der Binnenperspektive ein erheblicher Nachholbedarf.92d
Die anhaltende Krise führte auch in der Schweiz zur Entstehung einer rechtsbürgerlichen antimarxistischen „Bewegung“, wie es im Jargon der Zeit hieß, der Frontenbewegung. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland im Frühjahr 1933 spürten die dem Faschismus nahestehenden Gruppen zwar Aufwind, konnten jedoch keine größeren politischen Erfolge erzielen. Trotz erheblicher politischer Spannungen, einer Vertrauenskrise der Landesregierung, scheiterte 1935 die von der Nationalen Front lancierte Volksinitiative zur Totalrevision der Bundesverfassung, mit der eine faschistische Umgestaltung herbeigeführt werden sollte. Die seit 1933 verstärkte faschistische Bedrohung - Italien wurde bereits seit mehr als einem Jahrzehnt von Faschisten unter Mussolini regiert, in Spanien stand der Bürgerkrieg vor der Tür - führte die SP und die Gewerkschaftsbewegung mit den bürgerlichen Parteien enger zusammen. Die SP gab ihre Oppositionsrolle auf und erkannte die Landesverteidigung und die Demokratie in einem neuen Parteiprogramm an. Gleichzeitig schaffte der Bundesrat 1936 mit der Abwertung des Frankens um 30 % die Voraussetzungen für eine Erholung der Exportwirtschaft und ein Ende der Wirtschaftskrise. 1937 läutete das Friedensabkommen in der Metall- und Uhrenindustrie zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen das Zeitalter des Arbeitsfriedens und der Gesamtarbeitsverträge ein.
Flüchtlingspolitik, Geistige Landesverteidigung, Anerkennung des Rätoromanischen
Nach der Einführung der Nürnberger Rassengesetze in Deutschland verstärkte sich die Auswanderung und Flucht deutscher Juden. Da die Schweiz nur politischen Flüchtlingen Asyl gewährte und nicht Verfolgten „aus Rassengründen“ verlangte Heinrich Rothmund, Chef der Fremdenpolizei, 1938 von Deutschland Maßnahmen, die es den Schweizer Grenzbeamten ermöglichen sollten, jüdische Flüchtlinge mit deutschem Pass zu identifizieren. Darauf begann Deutschland Pässe von Juden mit einem J-Stempel zu kennzeichnen. Auch an der Konferenz von Evian 1938 verweigerte die Schweiz die dauerhafte Aufnahme eines bestimmten Kontingents von Flüchtlingen und bestand darauf, einzig ein Transitland zu bleiben, weshalb nur Emigranten in die Schweiz einreisen durften, die glaubhaft machen konnten, baldmöglichst weiterreisen zu können.92g
Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland kehrte die Schweiz zurück zur integralen Neutralität, was vom Völkerbund anerkannt wurde. Unter dem Eindruck der deutschen Expansion bekräftigten Schweizer Politiker, Gelehrte und Militärs den geistigen und militärischen Widerstands- und Selbstbehauptungswillen der Schweiz. Die Geistige Landesverteidigung, die Stärkung von als «schweizerisch» wahrgenommenen Werten und Bräuchen, um damit totalitäre Ideologien abzuwehren, wurde zu einem prägenden Element für das Kultur- und Geistesleben bis weit in die Nachkriegszeit.
1938 wurden in zwei Volksabstimmungen das Rätoromanische als vierte Landessprache anerkannt und das Schweizerische Strafgesetzbuch eingeführt.
Zweiter Weltkrieg: Staatsnotstand, Widerstandspläne, Flüchtlinge, NS-Propaganda
Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs berief sich die Schweiz erneut auf die bewaffnete Neutralität und ordnete die allgemeine Mobilmachung unter dem Oberbefehlshaber General Henri Guisan an. Das Parlament gewährte dem Bundesrat unter Berufung auf einen Staatsnotstand und in Anwendung von so genanntem extrakonsitutionellem Notstandsrecht eigentlich verfassungswidrige, umfassende Vollmachten, unmittelbar Maßnahmen zur Verteidigung der Schweiz und ihrer wirtschaftlichen Interessen zu ergreifen, die erst nachträglich von der Legislative bewilligt werden mussten.
Während des deutschen Einmarsches in Frankreich fielen der Wehrmacht in La Charité-sur-Loire geheime Pläne in die Hände, die schweizerische und französische Absprachen im Falle eines deutschen Angriffes auf die Schweiz enthüllten. Am 10. Mai 1940 löste die Armee die Zweite Generalmobilmachung aus. Während des Frankreichfeldzuges flohen Anfang Juni 1940 etwa 42.000 französische und polnische Soldaten in die Schweiz und wurden bis 1941 interniert und dann zum Teil nach Frankreich zurückgeführt. Nach der französischen Niederlage setzte General Guisan den Réduitplan zur weiteren Verteidigung der nun völlig von den Achsenmächten eingeschlossenen Schweiz um. Im Fall eines deutschen Einmarsches wäre danach das Mittelland mit seiner Zivilbevölkerung preisgegeben und der Widerstand auf das Alpenmassiv konzentriert worden.
Zeitweise planten die Achsenmächte in Generalstabs-Planspielen die Invasion der Schweiz (Unternehmen Tannenbaum).94 In diesem Zusammenhang wurde auch von Rorschach aus mit dem am 4. Februar 1936 ermordeten Wilhelm Gustloff die Grundlage für eine nationalsozialistische Politik in der Schweiz gelegt. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten im Januar 1933 hatte Gustloff, seit 1929 Mitglied der NSDAP, seine Aktivitäten verstärkt und ein Netz von „Stützpunkten“ in Bern, Glarus, Lausanne und Zuoz sowie Ortsgruppen in Davos, Lugano, Zürich und Basel angelegt. Mitte 1934 waren es insgesamt 27 Stützpunkte, 14 Ortsgruppen, an 7 Orten gab es HJ- und BdM-Gruppen, und eine ausgebaute Landesorganisation mit Sekretariat, Adjutant, Propagandaleiter, Schatzmeister und Presseobmann. Bis 1936 warb er unter den 100.000 Auslandsdeutschen in der Schweiz mehr als 5.000 als Parteimitglieder an, fand für den Nationalsozialismus auch unter den Schweizern Sympathisanten und Gönner, ohne jedoch die dortige Öffentlichkeit gewinnen zu können. Seine Propagandatätigkeit und die Durchführung von Wahlveranstaltungen auf Schweizer Boden führte im Dezember 1933 zur ersten einer Reihe von parlamentarischen Anfragen, die vom Bundesrat Johannes Baumann im September 1935 aus außenpolitischen Gründen hinhaltend beantwortet wurden. Gleichwohl drohte ab Mitte 1935 die Ausweisung Gustloffs, nachdem dessen Propagandablatt Der Reichsdeutsche bekannt gemacht hatte, dass die politischen Leiter der Schweizer NSDAP/AO auf Adolf Hitler vereidigt worden waren.
Der Gesandte Ernst von Weizsäcker konnte zwar die Schweizer Politik zum Einlenken bringen, diese konnte aber die Zeitungen nicht zügeln, die nun auch eine Verwicklung Gustloffs in die Entführung Berthold Jacobs behaupteten. Als Jude und Kritiker der illegalen Aufrüstung in der Weimarer Republik war er 1933 direkt nach der „Machtübernahme“ außer Landes geflohen. Er wurde von den Nationalsozialisten zweimal im neutralen Ausland entführt und nach Deutschland verschleppt. Das erste Mal bestand die Schweiz nach öffentlichen Protesten auf seiner Rückführung, das zweite Mal wurde er heimlich aus Lissabon nach Berlin verschleppt, wo er 1944 an den Folgen einer mehrjährigen Gestapo-Haft starb.
Weizsäcker musste sich, auch wenn er gegen Angriffe der Presse auf deutsche Regierungsmitglieder demarchierte, vom Bundesrat aufklären lassen, dass die Schweizer Verfassung keinen Maulkorb für die Presse vorsehe. Schließlich belastete Gustloff der Fall des Nationalsozialisten Hans Kittelmann, der als Jurist beim Schweizer Parlament als Parlamentsstenograf beschäftigt war und, als dies bekannt wurde, seine Mitgliedschaft in der Schweizer Landesgruppe der NSDAP/AO aufgeben musste. Als Gustloff Kittelmann ersatzweise die Mitgliedschaft in der NSDAP-Organisation der Berliner Zentrale verschafft hatte, wurde Kittelmann entlassen. Das St. Galler Tagblatt forderte einmal mehr das Politische Department und dessen Bundesrat Giuseppe Motta unter der Überschrift Quousque tandem? - in Anspielung auf die Verschwörung des Catilina im antiken Rom - zu einem schärferen Vorgehen gegen die NSDAP in der Schweiz auf.

Nach Gustloffs Rückkehr am 4. Februar 1936 erschoss ihn der kaum 27jährige Medizinstudent David Frankfurter, Sohn eines kroatisch-deutschsprachigen Rabbiners, in Davos. Der geständige David Frankfurter wurde unter großem internationalem Interesse am 14. Dezember 1936 in Chur zu 18 Jahren Haft und anschließender lebenslänglicher Landesverweisung verurteilt. Nach Kriegsende wurde Frankfurter am 1. Juni 1945 aufgrund eines Gnadengesuchs freigelassen und aus der Schweiz ausgewiesen. Erst 1969 nahm der Große Rat des Kantons Graubünden die Landesverweisung zurück.
Vom eigentlichen Krieg blieb die Schweiz zwar weitgehend verschont, aber nicht unberührt. Neben deutschen Luftraumverletzungen in der ersten Kriegsphase führte der Bombenkrieg der Alliierten bis Kriegsende zu häufigen Überflügen und versehentlichen Bombardierungen von Schweizer Städten und Dörfern, auch weil die Schweiz auf Druck der Achsenmächte die Verdunkelung einführte. Schweizer Territorium wurde insgesamt 77-mal bombardiert, 84 Menschen kamen dabei ums Leben. Der schwerwiegendste Zwischenfall mit 40 Toten (29 Männer, 9 Frauen, 2 Kinder), über 100 Verletzten sowie Verlust von Kulturgütern war die Bombardierung von Schaffhausen am 1. April 1944.95 47 B-24 „Liberator“-Bomber warfen 378 Spreng- und Brandbomben auf die Stadt. 271 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt und 465 obdachlos. Über 1000 Arbeiter wurden durch die Zerstörung ihrer Fabriken arbeitslos. Das Naturhistorische Museum auf dem Herrenacker wurde weitgehend zerstört, auch das Museum zu Allerheiligen wurde bombardiert. Dabei wurde fast das gesamte Werk des Schaffhauser Renaissance-Künstlers Tobias Stimmer zerstört. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt entschuldigte sich bei der Bevölkerung von Schaffhausen und die USA leisteten 40 Millionen Franken Wiedergutmachung.
Von 1939 bis 1945 beherbergte die Schweiz bei einer Gesamtbevölkerung von weniger als vier Millionen während kürzerer oder längerer Zeit insgesamt knapp 300.000 Schutzsuchende. Darunter fielen so unterschiedliche Kategorien wie internierte Militärpersonen (103.000), temporär aufgenommene Grenzflüchtlinge (67.000), Kinder auf Erholungsurlaub (60.000), Zivilflüchtlinge (51.000, von denen 21.000 jüdischer Abstammung waren), Emigranten (10.000) und politische Flüchtlinge (250). Angesichts der prekären Versorgungslage war die Aufnahme von Flüchtlingen in Politik und Bevölkerung umstritten. Bundesrat Eduard von Steiger prägte in diesem Zusammenhang das politische Schlagwort „das Boot ist voll“.
Erst im Juli 1944 wurden Juden als politische Flüchtlinge anerkannt. Nach neueren Untersuchungen wurden ca. 24.398 Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen. Eine Untersuchung in Genf hat jedoch gezeigt, dass trotz der theoretisch geschlossenen Grenze 86 % der «illegalen» Flüchtlinge aufgenommen wurden.95c
Ende der Parteienkämpfe, Parteienverbote und Zensur, erste direkte Steuer, „Anbauschlacht“
Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg wurde ab 1939 die soziale Belastung aufgrund des aktiven Dienstes der Wehrmänner durch die Einführung der Lohn- und Verdienstersatzordnung vermindert, so dass Unruhen ausblieben. Trotzdem wurde die SP in den Parlamentswahlen 1943 mit 56 Sitzen zur stärksten Fraktion im Nationalrat. Die Wahl des Sozialdemokraten Ernst Nobs in den Bundesrat besiegelte die Integration der SP in das Parteiensystem und das Ende der Kämpfe zwischen Bürgerblock und Sozialisten. Die öffentliche Meinung wurde durch die Zensur (Abteilung Presse und Funkspruch) kontrolliert, extremistische und staatsgefährdende Propaganda wurde verboten. 1940 wurden die Kommunistische Partei der Schweiz und die Nationale Bewegung der Schweiz verboten. Zahlreiche Schweizer und Ausländer wurden während des Krieges wegen Spionage für Deutschland verhaftet. Über 1000 Schweizer Nationalsozialisten kämpften im Verlauf des Krieges in der deutschen Waffen-SS. Insgesamt wurden 33 Männer während des Dienstes wegen Landesverrats zum Tode verurteilt, wobei 17 Urteile vollstreckt wurden. Zahlreiche weitere Personen wurden zu Haftstrafen verurteilt oder ausgebürgert bzw. ausgewiesen.
Durch die frühzeitige wirtschaftliche Vorbereitung und die schnelle Einführung der Rationierung wie auch die „Anbauschlacht“ konnte der Bundesrat die Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen. Die hohen finanziellen Belastungen für den Bundeshaushalt machten die Erhebung von einmaligen Zusatzsteuern und 1941 die Einführung einer Wehrsteuer auf Einkommen und Vermögen nötig, die bis heute als direkte Bundessteuer überdauert.
Wirtschaftsabkommen mit Deutschland
Nach der Einkreisung der Schweiz durch die Achsenmächte schloss der Bundesrat mit Deutschland ein Wirtschaftsabkommen, um den Austausch von Kohle, Stahl und anderer kriegswichtiger Güter zu regeln. Die Schweiz musste Deutschland Kredite im Umfang von einer Milliarde Franken gewähren, sie konnte trotz der Blockade aber weiter kriegswichtige Präzisionsinstrumente an die Alliierten liefern. Die Alliierten führten seit 1939 Schwarze Listen, um die Maschinenindustrie zur Einstellung der Exporte nach Deutschland zu zwingen.
Erst im März 1945 einigten sich die Schweiz und die Alliierten im Currie-Abkommen, so benannt nach dem Leiter der amerikanischen Delegation Lauchlin Currie, auf ein Ende der schweizerischen Ausfuhren nach Deutschland und eine teilweise Auslieferung deutscher Vermögenswerte. Im Washingtoner Abkommen von 1946 gestand die Schweiz den Alliierten schließlich die Konfiszierung des gesamten deutschen Besitzes in der Schweiz zu.96 Der Streit um das sogenannte Raubgold, das über die deutsche Reichsbank in die Schweiz gekommen war, wurde mit der Zahlung von 250 Millionen Franken beendet. Danach hoben die Alliierten alle wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen gegen die Schweiz auf. Im selben Jahr nahmen die Schweiz und die Sowjetunion diplomatische Beziehungen auf. Die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wurde letztmals in den 1990er Jahren durch den Bergier-Bericht revidiert, benannt nach Jean-François Bergier, dem Präsidenten der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz–Zweiter Weltkrieg.
Die jüdischen Gemeinden seit 1933

Mit der Machtergreifung der NSDAP in Deutschland gerieten die Schweizer Juden ab 1933 unter zunehmenden Druck.97 Die judenfeindiche Propaganda wurde insbesondere in der Frontenbewegung, der Parallelbewegung der Schweiz zum Nationalsozialismus, aber auch in klein- und großbürgerlichen Kreisen aufgenommen und weitergetragen. Zugleich zeigten sich bei den Behörden in der Fremden-, Einbürgerungs- und Flüchtlingspolitik vielfach antisemitische Anteile, die Schweizer Juden zum Teil zur Auswanderung veranlassten. Die Flüchtlingspolitik der Schweiz, die nach von Bern angeregten Verhandlungen mit Berlin der Einführung des Judenstempels (Stempel „J“) 1938 zugestimmt hatte, verweigerte während des Krieges Tausenden von Flüchtlingen die Aufnahme.

Nach außen versuchte man sich in Unauffälligkeit, um den Nazis keine Angriffsfläche zu bieten, nach innen wurde die „Einheitsgemeinde“ als gemeinsames Dach aller religiösen und säkularen Ausrichtungen propagiert. Bald stand die Verteidigung der bürgerlichen Rechte und die Mobilisierung der inneren Kräfte, vor allem aber die Flüchtlingsarbeit in der Schweiz und die Hilfe für die Opfer der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in Europa im Mittelpunkt. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe betreute den überwiegenden Teil der 28.000 jüdischen Flüchtlinge, die von der Fremdenpolizei auch nach 1945 noch zur „Weiterwanderung“ aufgefordert wurden. In Genf residierte das Palästina-Amt der Zionistischen Organisation, und dort wurde 1936 auch der World Jewish Congress gegründet. Darüber hinaus entstanden hier die Kinderhilfe Œuvre de secours aux enfants, die ab April 1943 Kinder in die Schweiz schmuggelte, und Hicem, die 1927 gegründete jüdische Auswanderungshilfsorganisation.
Die 1948 erfolgte Gründung Israels, wohin etwa 3.000 Schweizer Juden auswanderten, absorbierte die Kräfte zugunsten der Aufbauarbeit im neuen Staat. Sympathisierten weite Teile der Bevölkerung im Krieg nach der Suezkrise (1956) und im Sechstagekrieg (1967) noch mit Israel, so waren vom Jom-Kippur-Krieg (1973) an in der öffentlichen Debatte der Schweiz auch antizionistische und antisemitische Argumentationsmuster zu hören. Anlässe waren die Diskussionen über die Rolle der Schweiz im Zweien Weltkrieg und die Frage der nachrichtenlosen Vermögen in den späten 1990er Jahren. Aber auch in die Debatte über das Schächtverbot anlässlich des Erlasses eines neuen Tierschutzgesetzes mischten sich antisemitische Stimmen.
Dennoch mehrten sich Anzeichen der Integration, wie etwa durch die Wahl der Gewerkschafterin Ruth Dreifuss 1993 in den Bundesrat und 1999 zur ersten Bundespräsidentin. Die jüdischen Glaubensgemeinschaften wurden in den Kantonen Basel-Stadt (1973), Freiburg (1990), St. Gallen (1993), Bern (1995) und Zürich (2005) öffentlich-rechtlich anerkannt und damit denchristlichen Landeskirchen gleichgestellt; der Kanton Waadt billigte 2001 der jüdischen Gemeinde den Status einer Institution von öffentlichem Interesse zu. 1946 entstand die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft, 1966 das Jüdische Museum der Schweiz in Basel, 1981 das Institut für Jüdisch-Christliche Forschung der Universität Luzern, 1982 die Schweizer Gesellschaft für Judaistische Forschung, 1995 die Dokumentationsstelle Jüdische Zeitgeschichte des Archivs für Zeitgeschichte der ETH Zürich, 1998 das Institut für Jüdische Studien der Universität Basel. 1989 und 1990 folgten Evangelisch und Katholisch-Jüdische Gruppen sowie 1992 die Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft der Schweiz. Auch gegenüber Leugnern des Holokaust gibt es inwischen einen gewissen Schutz.
2004 bestanden 23 jüdischen Gemeinden in der Schweiz. Viele der 18 im SIG organisierten Gemeinden sind sogenannte Einheitsgemeinden, die möglichst alle Strömungen zu integrieren versuchen, im Kultus meist traditionelle Formen bewahren, aber historisch-kritische Deutungen der Thora und des Talmuds zulassen und sich in das Privatleben ihrer Mitglieder nicht einmischen. Orthodoxe Überzeugungen hingegen verfechten die Israelische Religionsgesellschaft Zürich, die Jüdische Gemeinde Agudas Achim Zürich, die Jüdische Gemeine Luzern, die Israelische Religionsgemeinschaft Basel sowie die Comunità Israelita di Lugano (letztere drei sind nicht Mitglieder des SIG). Der seit 1970 bestehenden Communauté Israélite Libérale in Genf und der 1978 gegründeten Or Chadasch in Zürich, die u. a. Wiedereinsteiger bzw. bisher nicht Organisierte für das Judentum gewinnen möchten, wurde bisher vom SIG die Aufnahme verweigert.
Die Zuwanderung sephardischer Juden in der Westschweiz, dazu eingewanderte Israelis, steigern die sowieso starke Heterogenität der Gemeinden. Einige Gemeinden haben sich aufgrund von Überalterung aufgelöst (Pruntrut, Yverdon, Avenches, Solothurn, Davos, Delsberg), andere wiesen 2004 nur noch sehr wenige Mitglieder auf (Bremgarten AG, Kreuzlingen, Endingen, Lugano). Hingegen verfügen die größeren Gemeinden über ein Netz an Vereinen, Stiftungen und Kultur- und Wohltätigkeitsorganisationen. Die 1952 in Lugano gegründete Talmudhochschule, die 1954 nach Luzern und 1968 nach Kriens umzog, wurde 2005 von etwa 120 Schülern besucht.
Nachkriegszeit und Kalter Krieg: Wirtschaftsaufschwung, Konkordanz, Aufrüstung und Ende der Geistigen Landesverteidigung sowie des Vollmachtenregimes, Frauenwahlrecht (bis 1991)
Die Schweiz sah sich im Kalten Krieg in ihrer langen Tradition als politisch und militärisch neutral, gehörte aber ideologisch zum liberal-westlichen Lager. Das Land trat aus Neutralitätsgründen weder der UNO noch der NATO bei. Der europäische Sitz der UNO blieb nach der Auflösung des Völkerbunds dennoch in Genf. Die Supermächte USA und Sowjetunion bewerteten 1945 diese Haltung negativ, trotzdem waren sie bestrebt, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen, was sich im Abschluss des Washingtoner Abkommens, des Abkommens über deutsche Vermögenswerte in der Schweiz niederschlug.98 Dem Internationalen Gerichtshof trat die Schweiz am 28. Juli 1948 bei.99
Vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit war die nicht vom Krieg zerstörte Schweiz wirtschaftlich ein wichtiger Faktor in Mitteleuropa. Der beginnende Kalte Krieg führte besonders seit 1951 zu einer unter hohen Kosten vorangetriebenen Aufrüstung. Die Wehrpflicht in der Milizarmee dauerte vom 20. bis zum 50. Lebensjahr. Bis 1967 wurden auch erste Schritte zu einer atomaren Aufrüstung unternommen, die Schweiz galt als atomares Schwellenland. Mit der Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrags 1969 gab sie dieses Ziel auf.100
Die seit etwa 1932 geförderte Geistige Landesverteidigung richtete sich in der Nachkriegszeit gegen die Gefahr einer Besetzung des Landes durch die Truppen des Warschauer Pakts bzw. gegen die kommunistische Unterwanderung. Aus diesem Grund wurden 1956 rund 10.000 Ungarn und 1968 rund 12.000 Tschechoslowaken aufgenommen, die vor der sowjetischen Intervention in ihren Ländern geflohen waren. Die Neutralität begünstigte die sogenannten „Guten Dienste“ der Schweiz, so dass dort wiederholt internationale Friedenskonferenzen, meistens in Genf, abgehalten wurden, zum Beispiel 1954 die Indochinakonferenz oder die Gipfeltreffen der Supermächte.
Weil die Schweiz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht beitreten wollte, gründete sie 1960 zusammen mit Dänemark, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und Großbritannien die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA). Am 6. Mai 1963 trat die Schweiz auch dem Europarat bei. 1970 unternahm der Bundesrat erste Schritte in Hinblick auf eine europäische Integration der Schweiz, die 1972 in ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mündeten. Im selben Jahr unterzeichnete die Schweiz auch die Europäische Menschenrechtskonvention.
Wirtschaftlich erlebte das Land von 1945 bis in die 70er Jahre eine noch nie gesehene Hochkonjunktur. In dieser Zeit wurden die Exporte nahezu verzehnfacht. Bei stetig steigender Bevölkerung - 1943 hatte die Schweiz knapp 4,3 Millionen Eiinwohner, im Jahr 2000 waren es 7,3, heute sind es über 8 Millionen - veränderte sich das Gesicht des Landes durch ausgedehnte Bautätigkeit und Mobilitätssteigerung der Bevölkerung. Besonders das Mittelland zwischen Genf und Lausanne und zwischen Bern und Zürich sowie St. Gallen verlor durch die Zersiedelung der Landschaft seinen ländlichen Charakter. Der wachsende Energiebedarf wurde durch den Bau von fünf Atomkraftwerken und den Ausbau der Wasserkraftgewinnung gedeckt. Die wirtschaftliche Entwicklung, besonders im Dienstleistungssektor, führte zu einer Steigerung der privaten Einkommen. Der Ausbau des Wohlfahrtsstaates (1947 Einführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1959 Invalidenversicherung) und die Verkürzung der Arbeitszeiten beschieden der Schweiz bis in die 1990er Jahre sozialen Frieden. Ende der 1950er Jahren nahm der Autoverkehr in der Schweiz stark zu. Das 1960 vom Parlament verabschiedete Gesetz über ein Nationalstrassennetz übertrug dem Bund die Kompetenzen für den Nationalstraßenbau.
Seit den 1960er Jahren gelangten zunehmend „billige“ Arbeitskräfte aus dem Ausland in die Bau- und Tourismusindustrie. Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung stieg zwischen 1960 und 1970 von 10 auf 17,5 %, wobei die Italiener die Hälfte stellten, da Italien 1948 mit der Schweiz einen Vertrag zur Vermittlung von Arbeitskräften geschlossen hatte. Seit dem Ende der Hochkonjunktur machten sich Überfremdungsängste bei Teilen der Bevölkerung bemerkbar. Mehrere Versuche, die Zahl der Ausländer durch sogenannte „Überfremdungsinitiativen“ (James Schwarzenbach) zu beschränken, scheiterten in Volksabstimmungen. Der Bundesrat versuchte zwar, mit der Schaffung des Saisonnierstatuts die dauerhafte Niederlassung der „Gastarbeiter“ zu verhindern, schuf damit jedoch nur Härtefälle und behinderte die Integration der Migranten.101 In Zürich entstand durch Albert Stocker die Schweizerische überparteiliche Bewegung zur Verstärkung der Volksrechte und der direkten Demokratie, bald „Anti-Italiener Partei“ genannt. Dabei schloss Stocker die „Norditaliener“ explizit aus.

Die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts auf Bundesebene scheiterte 1959 in einer Volksabstimmung. Waadt und Neuenburg führten es jedoch im selben Jahr auf kantonaler Ebene ein. Erst 1971 stimmten die einzig wahlberechtigten Schweizer Männer der Einführung zu und verdoppelten damit die Zahl der Stimmberechtigten. Auf kantonaler Ebene ließ zuletzt der Kanton Appenzell Innerrhoden 1991 auf Druck des Bundesgerichts Frauen an die Landsgemeinde zu. Die Frauen erhielten nach der politischen Gleichberechtigung 1981 auch jene auf gesellschaftlicher Ebene juristisch zugesprochen. 1984 wurde Elisabeth Kopp (FDP) als erste Frau in den Bundesrat gewählt.
Innenpolitisch wurde die Schweiz durch die seit 1959 erreichte Konkordanz unter den führenden Parteien geprägt, die sich in der sogenannten „Zauberformel“ bei der Verteilung der Bundesratssitze manifestierte. Die Konkordanz geriet erst nach dem Ende des Kalten Krieges 1989 und dem Aufstieg der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) in eine Krise, die 2003 zum Ende der Zauberformel führte.
In der Nachkriegszeit erschütterte eine Reihe von Affären und Skandalen das Vertrauen und führte zu politischen Veränderungen, so 1964 die Mirage-Affäre um ein Kampfflugzeug und 1989 der Fichenskandal, der als exemplarisch für die Vorstellung von einem „Schnüffelstaat“ galt, oder 1990 die Aufdeckung der P-26, einer geheimen Kaderorganisation zur Aufrechterhaltung des Widerstandswillens in einer besetzten Schweiz. Die Krise um die separatistische Bewegung im Berner Jura wurde hingegen 1979 auf demokratischem Weg durch die Gründung des Kantons Jura gelöst.
Die Bürger verweigerten dem Bundesrat bereits 1949 die Weiterführung des Vollmachtenregimes, indem das fakultative Referendum auch auf die dringlichen Bundesbeschlüsse ausgedehnt wurde. Die internationale Jugendbewegung führte 1968 und 1980 vor allem in Zürich zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und den Behörden. Politisch und gesellschaftlich kam es zu einer Ablösung der alten Eliten und zum Aufbrechen der Geistigen Landesverteidigung, gleichzeitig entstand aber auch eine konservative Gegenbewegung in den bürgerlichen Parteien. Eine markante gesellschaftspolitische Auseinandersetzung ergab sich in diesem Zusammenhang 1989 anlässlich der von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee herbeigeführten Abstimmung über eine Abschaffung der Armee. Trotz starkem Engagement von Politik, Behörden und Armee für die Beibehaltung der Armee stimmten 35,6 % der Stimmberechtigten der Initiative zu. Zusammen mit den Erschütterungen der Fichenaffäre bewirkte die Kontroverse um die Armee das endgültige Ende der Geistigen Landesverteidigung.
Partielle Aufhebung der Isolation, Wirtschaftskrise und Zuwanderung, Polarisierung in der Zuwanderungsfrage
Der Bundesrat scheiterte wiederholt, als er versuchte, die politische Selbstisolation der Schweiz zu beenden. 1986 lehnten die Wähler den Beitritt zur UNO und 1992 auch denjenigen zum Europäischen Wirtschaftsraum ab. Der Bundesrat hielt trotz wachsender Opposition rechts-bürgerlicher Kreise an seinem europäischen Integrationskurs fest und reichte im selben Jahr einen Antrag zum Beitritt der Schweiz zur EU ein. Der Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei, die sich als einzige Bundesratspartei gegen die europäische Integration stellte und die abweisende Stimmung im Volk drängten den Bundesrat auf den „bilateralen Weg“. Ohne Beitritt vollzog die Schweiz autonom EU-Recht nach und einigte sich zweimal in Bilateralen Verträgen auf eine Teilintegration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt sowie die Liberalisierung des Personen- und Güterverkehrs.
Die 1990er Jahre waren daneben durch geringes Wirtschaftswachstum geprägt, das einen starken Anstieg der öffentlichen Verschuldung zur Folge hatte. Gleichzeitig sahen sich die Kantone und Gemeinden einem intensiven Steuerwettbewerb ausgesetzt. Der Niedergang der Maschinen- und Textilindustrie führte besonders in der Ostschweiz zu einer bis in die Gegenwart anhaltenden Deindustrialisierung, zum Beispiel in Glarus und St. Gallen. Gleichzeitig nahm seit den 1980er Jahren die Internationalisierung der Unternehmensführungen drastisch zu, während Frauen weiterhin schwer Zugang fanden, die Liberalisierung der Finanzmärkte veränderte die Machtstrukturen und die Grundsätze der Selbstergänzung der Eliten. Nun sicherten nicht mehr Jurastudium oder Militär den Zugang zur Elite, sondern der Besuch als bedeutend anerkannter wirtschaftswissenschaftlicher Universitätsfortbildungen, und die Veränderung der Aktionärsstruktur brachte neue Gruppen in die Führungsebenen. So kam es zu einer Polarisierung zwischen einer transnationalen Gruppe von Unternehmensleitern, die keinen Bezug zur Schweizer Politik haben, und einer stärker ins schweizerische Machtgewebe eingebundenen Gruppe.
Während der 90er Jahre nahm die Schweiz zahlreiche Flüchtlinge auf, insbesondere aus Sri Lanka, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina (1992–1995) nahm die Schweiz fast 30.000 Schutzsuchende auf, während des Kosovo-Konfliktes (1998/99) waren es etwa 53.000.102 Als einer der letzten international anerkannten Staaten trat die Schweiz nach einer Volksabstimmung am 10. September 2002 der UNO bei.
Die Debatte um die Zukunft der Armee wurde auch in den 90er Jahren fortgesetzt. 1993 scheiterte eine Initiative knapp in einer Volksabstimmung mit ihrem Antrag, auf die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18 zu verzichten. Die Armee wurde durch eine erste Armeereform 1995 angepasst, konnte aber die strukturelle Krise, die durch das Ende des Kalten Krieges und damit den Wegfall der Bedrohungsszenarien ausgelöst worden war, erst durch die Armeereform XXI ansatzweise überwinden. Seit Ende der 90er Jahre stand die Weiterführung der Miliz bzw. eine Professionalisierung der Armee zur Debatte.
Am 10. Dezember 2003 wurde der Unternehmer Christoph Blocher von der Schweizerischen Volkspartei an Stelle von Ruth Metzler (Christlichdemokratische Volkspartei, CVP) in den Bundesrat gewählt. Damit endete die seit 1959 andauernde Phase der politischen Konkordanz im Bundesrat und machte einer verstärkten Polarisierung Platz. Formal blieb die Konkordanz jedoch auch bei der neuen Zusammensetzung der Landesregierung gewahrt. Die Abwahl Blochers als Bundesrat am 12. Dezember 2007 durch eine vorher erfolgte Absprache der Mittelinksfraktionen CVP, SP und der Grünen brachte die Uneinigkeit unter den Bundesratsparteien zum Vorschein. Die SVP sah sich nicht mehr durch die neu an Blochers Stelle gewählte gemäßigte SVP-Politikerin Eveline Widmer-Schlumpf vertreten und kündigte an, Opposition gegen die Landesregierung zu betreiben. Dies führte bei gleichzeitiger Beibehaltung der Vertretung in der Regierung zu parteiinternen Spannungen und letztlich zur Abspaltung der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) von der SVP.
Da die beiden SVP-Bundesräte Eveline Widmer-Schlumpf und Samuel Schmid sich der BDP anschlossen, war die SVP bis zum Rücktritt von Samuel Schmid Ende 2008 nicht mehr im Bundesrat vertreten. Die Parlamentswahlen 2011 bestätigten mehrheitlich die Erwartungen. Die Grünliberalen und der BDP konnten sich etablieren und legten am deutlichsten zu. Alle anderen Parteien verloren Wähleranteile, am meisten die FDP und die SVP. In der Vereinigten Bundesversammlung ergaben sich folgende Verschiebungen: SVP −10 Sitze (nunmehr 59 Sitze), SP +5 (57), FDP −6 (51), CVP −5 (41), Grüne −5 (17), GLP +10 (14), BDP +10 (10). Im Bundesrat stellte nun ein Bündnis der Mitte-links-Parteien SP, CVP und BDP mit vier Sitzen die Mehrheit, nachdem die SVP mit ihrem Angriff auf Bundesrätin Widmer-Schlumpf in den Gesamterneuerungswahlen gescheitert war.
Während der Wirtschaftsaufschwung um die Jahrtausendwende von kurzer Dauer war, wuchs die Volkswirtschaft 2006 bis 2008 wieder dank wachsender Exporte. Ökonomen und Politiker sahen die Erholung der Wirtschaft in einem Zusammenhang zu der seit 2002 eingeführten Personenfreizügigkeit mit der EU, dank der zahlreiche gut ausgebildete Fachkräfte zuwandern konnten. Als eines der wenigen Länder Europas wies die Schweiz aufgrund eines positiven Wanderungssaldos (2007: +75.400 Personen) ein Bevölkerungswachstum von 1,1 % auf.103 Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung stieg dadurch von 20,4 (April 2007) auf 21,1 % (April 2008).104 2008 wuchs die Bevölkerung sogar um 106.700 Personen (+1,4 %), was den größten Zuwachs seit 1963 darstellte. 85 % des Zuwachses waren auf Migration zurückzuführen.105
Mit der Wirtschaftskrise seit 2006, die 2008 die Schweiz erreichte, verfestigte sich ein Trend, bei dem das Wanderungssaldo die Zahl von 66.200 Personen erreichte. Belief sich im Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2013 der Anteil der Deutschen an den Zuwanderern aus den EU-27-/Efta-Ländern auf 39 %, so sank er bis 2013 auf 15 %. Zudem verließen viele deutsche Staatsangehörige das Land; hingegen stieg der Anteil der Griechen, Italiener, Portugiesen und Spanier aus der besagten Gruppe auf 50 %, Osteuropäer aus den EU-10-Staaten machten 17 % aus.
Stellten die Erwerbstätigen 1992 15 % der Zuwanderer, waren es 2013 bereits 48 %. 1991 verfügten nur 16 % der zugewanderten Erwerbstätigen über eine höhere Berufsbildung oder hatten eine Fachhochschule oder Universität absolviert, 2013 waren dies 58 %. Zwei von drei 2012 zugewanderten Erwerbspersonen übten im zweiten Quartal 2013 einen hochqualifizierten Beruf aus. Gleichzeitig verließen zwischen 1991 und 2001 durchschnittlich 29.700 Schweizer ihr Land, 24.400 kehrten zurück; inzwischen liegt der Einwanderungsgewinn bei nur noch 6.000.106
Während 1970 in der Schweiz 16.353 Muslime lebten, waren es 1990 bereits 152.217 und im Jahr 2000 zählte man über 320.000 aus 105 Staaten, 11 % waren Schweizer. Sie kamen entweder seit den 1960er Jahren als Arbeitskräfte oder als Flüchtlinge und Asyl Suchende. 21 % stammten aus der Türkei, 58 % waren Albaner aus dem Kosovo oder Mazedonien sowie Bosniaken. Rund drei Viertel waren Sunniten, 20.000 Schiiten, 10-15 % Aleviten und Sufis. Eine erste Moschee entstand 1963 in Zürich, eine zweite 1978 in Genf. Ihre öffentlich-rechtliche Anerkennung wurde 2003 im Kanton Zürich abgelehnt. Dort entstand 2004 das Forum für einen fortschrittlichen Islam. Nur die Islamische König Faysal Stiftung in Basel und die Fondation culturelle islamique in Genf, die von Saudi-Arabien unterstützt werden, werden nicht von ihren Mitgliedern getragen. In den letzten Jahren forderten Vertreter der Dachvereine die Gründung einer deutsch- bzw. französischsprachigen Ausbildungsstätte für die künftigen Imame in der Schweiz, in der Moscheen nach einem Volksentscheid im Jahr 2009 nur ohne Minarett gebaut werden dürfen.
Von Mai 2013 bis April 2014 kamen 151.852 Ausländer in die Schweiz, davon 32 % als Familiennachzug, 47,4 % als Erwerbstätige, nur 2,1 % stellte die Gruppe der Flüchtlinge.107 2014 lag der Ausländeranteil bei 23,5 %, mit 10,1 % war er in Appenzell am niedrigsten, mit 37,6 % in Genf am höchsten.108
Verwaltung des Kulturerbes


Berücksichtigt man die bei wenig mehr als 8 Millionen liegende Einwohnerzahl des kleinen Landes, so ist die Schweiz das wohl museenreichste Land der Welt. Auf der Website museums.ch finden sich (Stand: November 2014) 1.150 Museen.109, die auch der Schweizer Museumsführer verzeichnet. Bis Mai 2017 stieg diese Zahl auf 1.230.
Neben den allgemeinen und wissenschaftlichen Bibliotheken, für die es entsprechende Verbünde gibt, existiert eine Liste von Spezialbibliotheken.110 Das zentrale Erschließungsmittel für die Bestände ist der Schweizer Virtuelle Katalog.111
Auch die Archive sind in Verbänden organisiert und treiben derzeit die Digitalisierung ihrer Bestände voran,112 ebenso wie die Archivare sich im Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare 1922 organisierten. Dieser Verein pflegt wiederum seit langem gute Beziehungen zur Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz, der heutigen Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte. Die Archive der 26 Kantone und Halbkantone bewahren die schriftliche und bildliche Überlieferung in der Schweiz. Die Archive der 13 alten Orte belegen die Geschichte der vor 1798 politisch tragenden Stände, die Beziehungen dieser Stände untereinander sowie zu Zugewandten und zum Ausland, darüber hinaus die Verwaltung der Gemeinen und speziellen Herrschaften. Das 1936 bezogene museumsartige Bundesbriefarchiv in Schwyz verweist exemplarisch auf die Bundesbriefe, wie sie in anderen Kantonsarchiven auch zu finden sind, mit Ausnahme des Bundesbriefes von 1291. Dem Typus der Archive der 13 Orte vergleichbar sind die Archive der verbündeten Länder Graubünden und Wallis sowie der Stadt Genf. Die Archive der nach 1803 entstandenen neuen Kantone verfügen über Bestände ehemaliger Herrschaften, Gerichte, Vogteien, Distrikte, geistlicher Institute. Letztere gelangten jedoch meist in die Staatsarchive. Einige Häuser verfügen über Privatarchive, wie das jurassische Archiv, das erst 1979 entstand. Eigene Gebäude erhielten die Archive erst nach und nach, beginnend 1899 mit Basel-Stadt, gefolgt von Bern 1949.113 Die Suchmaske des Archivarsvereins listet 290 Archive auf.114
Zahlreiche archäologische Fundstätten bilden den Fundus für eine große Zahl von archäologischen Verbänden und Institutionen.115 1971 entstand die Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen, die die Zusammenarbeit der kantonalen archäologischen Dienste und die Ausbildung fördert, aber auch die Interessen gegenüber Behörden und Dritten vertritt. Daneben besteht Archäologie Schweiz, ein Verein mit (nach eigenen Angaben) rund 2000 Mitgliedern, zwei Drittel davon sind allgemein an Archäologie Interessierte, ein Drittel Fachleute. Sie ist 1907 als Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte gegründet worden.
Die stark verspätete Aufarbeitung der Rolle der Wissenschaften während des Nationalsozialismus zeigt, dass vor allem die Anthropologie auch nach 1945 rassistischen Zielen folgte. Doch selbst die enorme Datenmasse, die die Anthropometrie aufgehäuft hatte, konnte schließlich keine signifikanten Unterscheidungsmerkmale zwischen den Rassen erweisen. Im Gegenteil ergab die Korrelation aller erhobenen anthropologischen Merkmale durch die Hollerith-Maschine, dass gerade einmal 1,571 % der bis 1932 für die Anthropologia Helvetica erfassten 35.000 Wehrpflichtigen als rein „nordisch“ zu bezeichnen waren, hingegen entfielen 91,339 % auf biologische „Kreuzungsprodukte“.115c Es war vor allem das Walsertal, in dem man vergeblich nach einer „reinen“ Schweizer Bevölkerung suchte. Wie in weiten Arealen der Wissenschaften, so wurden Prämissen, wie die biologisch bestimmte Ausprägung des Sozialen, erst nach ihrem Scheitern und dann erst Generationen nach dem Abtreten der alten Wissenschaftseliten aufgegeben, und nachdem deutlich wurde, wie auch Schweizer Wissenschaftler der Eugenik und den rassistisch motivierten Verfolgungen des 20. Jahrhunderts Vorschub geleistet hatten.
Fachzeitschriften
- Archäologie Schweiz115f
- Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte116
- Jahrbuch Archäologie Schweiz = Annuaire d'Archéologie Suisse = Annuario d'Archeologia Svizzera = Annual review of Swiss Archaeology117
- Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte118
- Schweizerische Zeitschrift für Geschichte119
Quelleneditionen
- Corpus Inscriptionum Medii Aevi Helvetiae. Die frühchristlichen und mittelalteriichen Inschriften der Schweiz, 5 Bde, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1977-1997 (gegr. 1971 von Carl Pfaff). (Christoph Jörg (Hg.): Bd. 2, 1984 (Inschriften aus Genf, Waadt, Neuenburg, Jura, Freiburg), Google Books, Wilfried Kettler u.a. (Hg.): Bd. 3, 1992 (Inschriften aus Aargau, Basel, Bern, Solothurn), Google Books, Marina Bernasconi (Hg.): Bd. 5, 1997 (Inschriften aus Ticino, Grigioni), Google Books)
- Der St. Galler Klosterplan. Faksimile, Begleittext, Beischriften und Übersetzung. Mit einem Beitrag von Ernst Tremp, hgg. von der Stiftsbibliothek St. Gallen, Verlag am Klosterhof, St. Gallen 2014. (Rezension)
- Alfred Kölz (Hg.): Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte. 2 Bde. Stämpfli, Bern 1992–1996 (Band 1: Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Band 2: Von 1848 bis in die Gegenwart).
- Anton von Sprecher, Markus Lutz: Vollstaendiges geographisch-statistisches Hand-Lexikon der schweizerischen Eidgenossenschaft. H. R. Sauerlaender, 1856 (Google eBook).
- Heinold Fast, Walter Schmid, Leonhard von Muralt, Martin Haas (Hg.): Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz, 3 Bde. Bd. 1: 1952, Bd. 2: Ostschweiz, Hirzel, 1973, (Bd. 3: Aargau-Bern-Solothurn, Theologischer Verlag Zürich, 2008, Google Books)
- Diplomatische Dokumente der Schweiz - Zwischen 1979 und 1997 erschienen 15 Bände, die den Zeitraum von 1848 bis 1945 abdecken, die zweite Serie umfasst die Zeit bis 1989 in Form einer Datenbank (seit 1997 online).
Literatur
- Helmut Weissert, Iwan Stössel: Der Ozean im Gebirge. Eine geologische Zeitreise durch die Schweiz, vdf Hochschulverlag AG, 1. Aufl. 2008, 2. überarb. Aufl. 2010. (Google Books)
Überblickswerke
- Beatrix Mesmer, Ulrich Im Hof: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Schwabe, Basel 2004.
- Hanno Helbling (Hg.): Handbuch der Schweizer Geschichte, 2 Bde, Zürich 1972, 1977.
- Historisches Lexikon der Schweiz, 13 Bde, Schwabe, Basel 2002–2014.
- Historisches Lexikon Bayerns, Online-Sachlexikon, München 2005ff. (z. B. zum Schwabenkrieg/Schweizerkrieg, 1499; keine Orts- oder Personenartikel)
- Ulrich Im Hof: Mythos Schweiz. Identität – Nation – Geschichte 1291–1991. NZZ, Zürich 1991.
- Ulrich Im Hof: Geschichte der Schweiz. Mit einem Nachwort von Kaspar von Greyerz. Kohlhammer, Stuttgart 2007. (Google Books)
- Georg Kreis (Hg.): Die Geschichte der Schweiz. Schwabe, Basel 2014 (Rezension).
- Thomas Maissen: Geschichte der Schweiz. Hier + jetzt, Baden 2010.
- Otto Marchi: Schweizer Geschichte für Ketzer oder die wunderbare Entstehung der Eidgenossenschaft, Praeger, Zürich 1971 / Zytglogge, Bern 1981 / Rotpunktverlag, Zürich 1985.
- Helmut Meyer u. a.: Die Schweiz und ihre Geschichte. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Zürich 1998.
- Volker Reinhardt: Die Geschichte der Schweiz. Von den Anfängen bis heute, Beck, München 2006. (Google Books)
- Volker Reinhardt: Kleine Geschichte der Schweiz, Beck, München 2010. (Google Books)
- Peter Stadler: Epochen der Schweizergeschichte. Orell Füssli, Zürich 2003.
- Christian Schütt, Bernhard Pollmann (Hg.): Chronik der Schweiz, Ex Libris, Zürich 1987.
- Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Administration des Historisch-biographischen Lexikons der Schweiz, Neuenburg 1921–1934.
- Jürgen Barkhoff, Valerie Heffernan (Hg.): Schweiz schreiben. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, Walter de Gruyter, 2010. (Google Books)
- Rudolf Pfister: Kirchengeschichte der Schweiz, Zwingli-Verlag, 1964.
- Harmjan Dam: Kirchengeschichte im Religionsunterricht. Basiswissen und Bausteine für die Klassen 5–10, Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. (Google Books)
- Michael Durst: Studien zur Geschichte des Bistums Chur (451-2001), Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2002. (Google Books)
Monumente
- Brigitt Sigel: Stadt- und Landmauern, Bd. 2: Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen (Weiterbildungstagung des Instituts für Denkmalpflege der ETH Zürich in Zurzach, 11. - 13. November 1993), vdf Hochschulverlag, Zürich 1996. (Google Books)
Atlanten und Kartenwerke
- Hektor Ammann, Karl Schib (Hg.): Historischer Atlas der Schweiz. Sauerländer, Aarau 1958.
- Jörg Rentsch, Dominik Sauerländer (Hg.): Putzger. Historischer Weltatlas – Schweizer Ausgabe. Cornelsen, Berlin 2004.
Urgeschichte
- Jon Mathieu, Norman Backhaus, Katja Hürlimann, Matthias Bürgi (Hg.): Geschichte der Landschaft in der Schweiz. Von der Eiszeit bis zur Gegenwart, Orell Füssli, Zürich 2016 (behandelt die letzten 20.000 Jahre).
- Jean-Marie Le Tensorer: Le Paléolithique en Suisse, Editions Jérôme Millon, 1998. (Google Books)
- Anthony Denaire, Thomas Doppler, Pierre-Yves Nicod, Samuel van Willigen: Espaces culturels, frontières et interactions au 5ème millénaire entre la plaine du Rhin supérieur et les rivages de la méditerranée, in: Annuaire d'Archéologie Suisse 94 (2012) 21-59. (online)
- Otto Tschumi: Urgeschichte der Schweiz, Huber & Company, 1949.
- Franz Schwerz: Die Völkerschaften der Schweiz von der Urzeit bis zur Gegenwart, 1915, ND Salzwasser, 2012.(Google Books)
- Jakob Heierli: Urgeschichte der Schweiz
A. Müller, 1901.
- Albert Hafner, Peter J. Suter: Das Neolithikum in der Schweiz, www.jungsteinSITE.de, 27. November 2003, in: Journal of Neolithic Archaeology 5 (2003). (online, PDF)
- Albert Hafner: Schnidejoch und Lötschenpass. Archäologische Forschungen in den Berner Alpen, Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 2015.
- Francesco Menotti: Lakeside Dwellings in the Circum alpine region, in: Chris Fowler, Jan Harding, Daniela Hofmann (Hg.): The Oxford Handbook of Neolithic Europe, 2015, S. 291-308. (Google Books)
- Franco Marzatico, Paul Gleirscher: Guerrieri principi ed eroi. Fra il Danubio e il Po dalla preistoria all'alto Medioevo, Provincia Autonoma di Trento, 2004.
Metallzeitalter, Kelten
- Thomas Knopf: Der Übergang von der Cortaillod- zur Pfyner Kultur am Zürichsee, in: Ders.: Kontinuität und Diskontinuität in der Archäologie, Waxmann, 2002, S. 126-157. (Google Books)
- Felix Müller, Geneviève Lüscher: Die Kelten in der Schweiz, Theiss, 2004.
- Andres Furger, Felix Müller: Gold der Helvetier. Keltische Kostbarkeiten aus der Schweiz, Ausstellungskatalog Schweizerisches Landesmuseum 16. Februar bis 12. Mai 1991, Zürich 1991.
- Bernhard Maier: Geschichte und Kultur der Kelten, Beck, München 2012. (Google Books)
- Simonetta Biaggio Simona: I Leponti: testimonianza della popolazione preistorica del Cantone Ticino», in: Bollettino Associazione Archeologica Ticinese (2000) 34-37. (online)
- Martin A. Guggisberg: Zur absoluten Chronologie der späten Hallstatt- und frühen Latènezeit: der Beitrag der Klassischen Archäologie, in: Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse nördlich der Alpen. Kolloquien und Arbeitsberichte des DFG SPP 1171: Kolloquium Bad Dürkheim April 2005: Chronologische Eckdaten zu den Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozessen während der Späthallstatt- und Frühlatènezeit, März 2006. (online, PDF)
Antike, Frühmittelalter
- R. C. de Marinis, Simonetta Biaggio Simona (Hg.): I Leponti. Tra mito e realtà, 2 Bde, Locarno 2000.
- Gerold Walser: Studien zur Alpengeschichte in antiker Zeit, Franz Steiner, 1994. (Google Books)
- Daniel Gut: Lunnern. Londons Zwilling im Reusstal: Eine sprach- und kulturgeschichtliche Verortung von Siedlungsnamen, Norderstedt 2009, 2. überarb. Aufl. 2010. (Google Books)
- Gerold Walser: Bellum Helveticum. Studien zum Beginn der caesarischen Eroberung von Gallien, Steiner, 1998. (Google Books)
- Andres Furger: Die Schweiz zwischen Antike und Mittelalter, NZZ Verlag, Zürich 1996.
- Katharina Winckler: Die Alpen im Frühmittelalter. Die Geschichte eines Raumes in den Jahren 500 bis 800, Böhlau, 2012.
- Heiko Steuer, Volker Bierbrauer (Hg.): Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, Walter de Gruyter, 2008. (Google Books)
- Michael Borgolte: Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie, Sigmaringen 1986.
- Hans Rudolf Sennhauser, Katrin Roth-Rubi, Eckart Kühne: Wandel und Konstanz zwischen Bodensee und Lombardei zur Zeit Karls des Grossen. Kloster St. Johann in Müstair und Churrätien, Tagung 13.–16. Juni 2012 in Müstair, vdf Hochschulverlag, 2013. (Google Books)
- Volker Gallé (Hg.): Die Burgunder. Ethnogenese und Assimilation eines Volkes : Dokumentation des 6. wissenschaftlichen Symposiums, veranstaltet von der Nibelungenliedgesellschaft Worms e.V. und der Stadt Worms vom 21. bis 24. September 2006, Worms, Worms Verlag, 2008.
- Elsbeth Hörtl: Burgundiones - Ethnogenese und Ansiedlung, Dipl., Wien 2012. (online, PDF)
- Hans Rudolf Sennhauser (Hg.): Wandel und Konstanz zwischen Bodensee und Lombardei zur Zeit Karls des Grossen. Kloster St. Johann in Müstair und Churrätien, Tagung 13.–16. Juni 2012 in Müstair, vdf Hochschulverlag, 2012. (Google Books)
- Andrea Zur Nieden (Hg.): Der Alltag der Mönche. Studien zum Klosterplan von St. Gallen, Diplomica Verlag, 2008. (Google Books)
Hoch- und Spätmittelalter
- Franco Morenzoni: Le prédicateur et l'inquisiteur. Les tribulations de Baptiste de Mantoue à Genève en 1430, Presses Universitaires Lyon, 2007. (Google Books)
- Leonardo Broillet: A cavallo delle Alpi. Ascese, declini e collaborazioni dei ceti dirigenti tra Ticino e Svizzera centrale (1400-1600), FrancoAngeli, 2014. (Google Books)
- Roger Sablonier: Gründungszeit ohne Eidgenossen. Politik und Gesellschaft in der Innerschweiz um 1300, Hier und Jetzt, Baden 2008.
- Hans-Jörg Gilomen: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im Spätmittelalter, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 41 (1991) 235-248.
Neuzeit
- Norbert Furrer (Hg.): Gente ferocissima. Solddienst und Gesellschaft in der Schweiz (15.-19. Jahrhundert), Festschrift für Alain Dubois, Editions d'en bas, 1997. (Google Books)
- Francisca Loetz: Mit Gott handeln. Von den Zürcher Gotteslästerern der Frühen Neuzeit zu einer Kulturgeschichte des Religiösen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. (Google Books)
- Rolf Graber: Wege zur direkten Demokratie in der Schweiz. Eine kommentierte Quellenauswahl von der Frühneuzeit bis 1874, Böhlau, 2013. (Google Books)
- Marc Lerner: A Laboratory of Liberty. The Transformation of Political Culture in Republican Switzerland, 1750-1848, Brill, 2011. (Google Books)
- Daniel Krämer: «Menschen grasten nun mit dem Vieh». Die letzte grosse Hungerkrise der Schweiz 1816/17 (= Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte 4), Schwabe Verlag, Basel 2015.
- Thomas Maissen: Weshalb die Eidgenossen Helvetier wurden. Die humanistische Definition einer natio, in: Johannes Helmrath, Ulrich Muhlack, Gerrit Walther: Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, Göttingen 2002, S. 210-249. (online)
- Thomas Maissen: Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. Göttingen 2006. (Google Books)
- Martine Ostorero, Kathrin Utz Tremp (Hg.): Inquisition et sorcellerie en Suisse romande, Université de Lausanne, 2007.
Langes 19. Jahrhundert (bis 1918)
- Eduard Fueter: Die Schweiz seit 1848. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Zürich 1928.
- Rolf Graber: Demokratisierungsprozesse in der Schweiz im späten 18. und 19. Jahrhundert, Peter Lang, 2008. (Google Books)
- Hans Rudolf Kurz: Schweizerschlachten. 2., bearbeitete und erweiterte Auflage, Francke, Bern 1977, S. 165–171.
- Alfred Kölz: Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Stämpfli Velang, Bern 1992.
- Alfred Kölz: Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien in Bund und Kantonen seit 1848, Stämpfli Verlag, Bern 2004 (posthum).
- Hans Ulrich Jost, Monique Pavillon: Les avant-gardes réactionnaires. La naissance de la nouvelle droite en Suisse, 1890-1914, Editions d'en bas, 1992. (Google Books)
- Urs Altermatt: Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto. Die Entstehungsgeschichte der nationalen Volksorganisationen im Schweizer Katholizismus 1848-1919, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1995. (Google Books)
- Georg Kreis: Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914-1918, Neue Zürcher Zeitung - Buchverlag, Zürich 2013 (leider ohne Überblick über die Forschungslage).120
- Adrian Gerber: Zwischen Propaganda und Unterhaltung. Das Kino in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs, Diss., Schüren, Marburg 2017.120c
- Thomas Bürgisser: «Unerwünschte Gäste». Russische Soldaten in der Schweiz 1915-1920, Theologischer Verlag Zürich, 2010. (Google Books)
Nachkriegszeit und umgebender Faschismus
- Urs Altermatt: Schweizer Katholizismus zwischen den Weltkriegen, 1920-1940, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1994. (Google Books)
- Kristina Schulz: Die Schweiz und die literarischen Flüchtlinge (1933-1945), Walter de Gruyter, 2012. (Google Books)
- Archimob, 1998 gegründetes Oral-History-Projekt zur Zeit von 1939-45.121
Jüngste Geschichte
- Jakob Tanner: Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert
, Beck, 2015. (Google Books)
- Thomas Maissen: Geschichte der Schweiz, Baden 2010, 5. erw. Aufl. 2016.
- Daniel Trachsler: Bundesrat Max Petitpierre. Schweizerische Aussenpolitik im Kalten Krieg 1945-1961, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2011.
- Nadine Ritzer: Der Kalte Krieg in den Schweizer Schulen. Eine kulturgeschichtliche Analyse, Bern 2015.
- Jonas Steinmann: Weichenstellungen. Die Krise der schweizerischen Eisenbahnen und ihre Bewältigung 1944-1982, Peter Lang, 2010. (Google Books)
- Adrian Vatter: Das politische System der Schweiz, UTB, 2013. (Google Books)
- Tina Lechner, Alexander Thomas: Beruflich in der Schweiz. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. (Google Books)
- Eva Schär, Ruedi Epple: Spuren einer anderen Sozialen Arbeit. Kritische und politische Sozialarbeit in der Schweiz 1900-2000, Seismo, Zürich 2015.
- André Mach, Thomas David, Stéphanie Ginalski, Felix Bühlmann: Les élites économiques suisses au XXe siècle, Neuchâtel 2016.
- André Holenstein, Patrick Kury, Kristina Schulz: Schweizer Migrationsgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hier und Jetzt Verlag, 2018.
Wissenschaftsgeschichte
- Susi Ulrich-Bochsler: Grabungstechnik. Einführung in die Archäoanthropologie für das archäologisch-technische Grabungspersonal, Basel 1993.
- Pascal Germann: Laboratorien der Vererbung. Rassenforschung und Humangenetik in der Schweiz 1900-1970, Wallstein, Göttingen 2016.
- Gilbert Kaenel, Pierre Crotti (Hg.): Les Lacustres. 150 ans d’archéologie entre Vaud et Fribourg, Lausanne 2004. (PDF)
- Daniel Möckli: Die Forschungsgeschichte der alpinen Archäologie – von den Anfängen bis heute, Seminararbeit, Universität Zürich 2010(?). (online)
- Franz Schwerz: Die Völkerschaften der Schweiz von der Urzeit bis zur Gegenwart, 1915, ND, Salzwasser Verlag 2012. (Google Books)
- Christoph Pfister: Die Entstehung der Jahreszahl 1291. Beiträge zur Schweizer Historiographie, BoD 2012. (Google Books)
- Jürgen Barkhoff, Valerie Heffernan (Hg.): Schweiz schreiben. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, Walter de Gruyter, 2010. (Google Books)
- Johann von Müller: Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft , z. B. Anderes Buch. Von dem Aufblühen der ewigen Bünde, Siebenter Theil, Frankenthal 1790 oder Erstes Buch: Von dem Anbau des Landes, 1, Leipzig 1787
- Johann von Müller: Der Geschichten Schweizerischer Eidggenossenschaft Vierter Theil. Bis auf die Zeiten des Burgundischen Kriegs, Weidmannische Buchhandlung, Leipzig 1805. (Google Books)
Bibliographien
- Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG)122, ab Berichtsjahr 1913 jährlich erscheinend und ab Berichtsjahr 1975 in einer Datenbank
- Rolf Hachmann (Hg.): Ausgewählte Bibliographie zur Vorgeschichte von Mitteleuropa, Franz Steiner Verlag, 1984 (v. a. S. 225-235). (Google Books)
Externe Links
Quellen
- Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS)
- Server für digitalisierte Zeitschriften (retro.seals)
- Epigraphische Datenbank Heidelberg
- Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins
Archäologische, museale und historische Institutionen
- Archäologie Schweiz
- Fachportal Altertumswissenschaften in der Schweiz
- Horizont 2015: Forum für die Schweizer Archäologie
- STARCH - Stiftung für Archäologie im Kanton Zürich
- Schweizerische Stein-Denkmäler - Inventar
- museums.ch. Die Plattform der Museen in der Schweiz (mit Museumssuche)
- International Council on Monuments and Sites Schweiz (ICOMOS)
- Schweizerisches Steindenkmäler-Inventar (SSDI)
- Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes (Pfahlbauten: UNESCO-Welterbe)
- infoclio.ch, das Fachportal für die Geschichtswissenschaften der Schweiz
- E-Pics, zentrale Bilddatenbank der ETH Zürich
- Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
- Bildungsgeschichte Schweiz, Universität Zürich
- Via Storia - Kulturwege Schweiz
- info flora. Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora
Dokumentationen und Filmbeiträge
- Mit offenen Karten: Die Schweiz - eine Insel in Europa, arte, 2014
- Faustkeil von Pratteln, Filmbeitrag
- Steinzeit Alltag. Pfahlbauer von Pfyn, Teil 1, Teil 2, SF, 2007.
- Kathedralen der Steinzeit: Europas frühe Monumente (Kreisgrabenanlagen an von LBK bewohnten Stellen wurden nach maximal drei Jahrhunderten zugeschüttet, Goseck, Frau von Ippesheim im Zentrum der Kreisanlage (Würzburger Raum), ähnlich wie im österreichen Friebritz (Pfeilschüsse), 4800-4500 v. Chr. Monumentalanlagen)
- Die Dämmerung der Kelten, 2008 (Grabungen am Mormont, der zwischen 120 und 80 v. Chr. eine Opferstätte - oder ein Heiligtum - der Helvetier war; die Ausgrabungen laufen noch)
- Die Alamannen: Wotans Krieger stürmen das Imperium, Filmbeitrag von Elli Gabriele Kriesch, Beiträge von Heiko Steuer, Wilfried Menghin, Wilhelm Störmer u. a.
- Kaiserin Adelheid - Die mächtigste Frau der Ottonen, Dokumentation unter Mitw. von Stefan Weinfurter, Gerd Althoff, MDR 2010.
- Die Schweiz im 19. Jahrhundert, Helvetische Republik bis Mediationsakte (1803), SRG, o.J.
- Landwirtschaft gestern: Ackerbau in der Schweiz um 1936
- 1799 - Die Schlachten von Zürich, Teil 2
- Die Schweiz im 19. Jahrhundert, Teil 2-6
- Bodenbearbeitung, Ackerbau in der Schweiz um 1936, Film-Archiv der Bucher Landtechnik AG
- Hitler garantiert die Neutralität der Schweiz 23. Februar 1937, Zeitzeichen, WDR 5
- Schweizer, vierteiliges Doku-Drama von Schweizer Radio und Fernsehen, 2013.
- Georg Kreis: Schweiz im Historischen Lexikon der Schweiz
- Marco Marcacci: Schweizerische Eidgenossenschaft im Historischen Lexikon der Schweiz
- Interaktiver Wahlatlas zu den Schweizer Nationalratswahlen seit 1919
- Swissworld, Kapitel «Geschichte»
- SRG SSR Timeline, Multimediale Chronik der Schweiz
- Politischer Atlas der Schweiz
- Christof Dipper: Schweiz – Die Geburt der Zeitgeschichte aus dem Geist der Krise, Version: 1.0, in: Docupedia Zeitgeschichte, 22. März 2011
- Schweizer Geschichte, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (swissworld.org)
Anmerkungen
- 1 ↑ Zu den frühesten Nachweisen von Feuergebrauch in Europa vgl.: Wil Roebroeks, Paola Villa: On the earliest evidence for habitual use of fire in Europe, in: PNAS (14. März 2011) doi:10.1073/pnas.1018116108
- 2 ↑ Bernard Wood: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, Wiley-Blackwell, 2011, S. 331 („The earliest fossils that most researchers would accept as H. neanderthalensis are from OIS 5 (i.e., c.130 ka).“)
- 3 ↑ Jean-Marie Le Tensorer: Paläolithikum, in: Historisches Lexikon der Schweiz.
- 4 ↑ Reto Jagher: Le galet aménagé de Walheim (Haut Rhin), témoin du Paléolithique ancien dans le Sundgau, in: Cahiers de l'Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace 17 (2002) 1-5.
- 5 ↑ Thierry Rebmann: Caractérisations pétroarchéologiques, provenances et aires de circulations des industries moustériennes différentes du silex en Région du Rhin Supérieur, entre la Moselle et le Jura. Stations de Mutzig et Nideck (Alsace, France), de Lellig (Luxembourg), et Alle (Canton du Jura, Suisse), Diss. Basel 2007, S. 162 ff. (online, PDF).
- 6 ↑ Eine Abbildung findet sich hier.
- 7 ↑ Jürg Tauber: Der Faustkeil von Pratteln, in: Jürg Ewald, Jürg Tauber (Hg.): Tatort Vergangenheit. Ergebnisse aus der Archäologie heute, Basel 1998, S. 94 f.
- 8 ↑ Abbildungen finden sich in der Web-Collection des Schweizerischen Nationalmuseums und der Seite der ETH Zürich.
- 9 ↑ Jean Detrey: Nouvelles données sur le Paléolithique moyen dans le Canton du Jura (Suisse) , in: Revue archéologique de l'Est 59,1 (2010) 7-45.
- 10 ↑ D'aqua e di Pietra. Il Monte Fenera e le sue collezioni museali.
- 11 ↑ Museo Buco del Piombo
- 12 ↑ Beitrag zur Trepanation mit Film (nichts für empfindliche Gemüter!).
- 12a ↑ Projekt Trepanationen der Schweiz.
- 13 ↑ Dazu: Jean-Luc Piel-Desruisseaux: Outils préhistoriques. Du galet taillé au bistouri d'obsidienne, 6. Aufl. Dunod, 2011, S. 252-255. (Google Books)
- 14 ↑ Gerd Albrecht: Reduzierte Silhouetten: Frauendarstellungen vom Petersfels, in: Archäologisches Landesmuseum Konstanz (Hg.): Eiszeit. Kunst und Kultur, Begleitband zur Großen Landesausstellung Eiszeit - Kunst und Kultur, im Kunstgebäude Stuttgart, 18. September 2009 bis 10. Januar 2010, Thorbecke, Ostfildern 2009, S. 307-311.
- 15 ↑ Denise Leesch, Werner Müller, Ebbe Nielsen, Jérôme Bullinger: The Magdalenian in Switzerland: Re-colonization of a newly accessible landscape, in: Quaternary International 272–273 (September 2012) 191–208.
- 16 ↑ Menschen am Rand des Eises, mit Abbildungen.
- 17 ↑ L’abri-sous roche-du-Mollendruz
- 18 ↑ René Wyss: Eine mesolithische Station bei Liesbergmühle (Kr. Bern), in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte / Revue suisse d'art et d'archéologie / Rivista svizzera d'arte e d'archeologia, Bände 17-18 (1957)
- 19 ↑ René Wyss: Ausgrabungen des Schweizerischen Landesmuseums im Wauwilermoos 1954-1987. Neue Forschungen zur Jungsteinzeit, Schweizerisches Landesmuseum, 1987.
- 20 ↑ Einen Anfang machte Wyss mit seiner Dissertation 1953: René Wyss: Beiträge zur Typologie der paläolithisch-mesolithischen Übergangsformen im schweizerischen Mittelland, Diss., Bern, Institut für Ur- und Frühgeschichte, 1953. S. a. Ders.: Zur Erfoschung des schweizerischen Mesolithikums, in: ZAK 20 (1960) 55-69.
- 21 ↑ Hans-Georg Bandi: Birsmatten-Basisgrotte. Eine mittelsteinzeitliche Fundstelle, 1964.
- 22 ↑ Michel Egloff: La Baume d'Ogens, gisement épipaléolithique du plateau Vaudois. Note préliminaire, 1965.
- 23 ↑ Pierre Crotti, Gervaise Pignat: Abri mésolithique de Collombey-Vionnaz. Les premiers acquis, in: Annales de la Société suisse de Préhistoire et d'Archéologie 66 (1983) 7-16.
- 24 ↑ La sequence chronologique de 1'abri Freymond pres du col du Mollendruz (Jura vaudois), in: Archeologie suisse 9,4 (1986) 138-148.
- 25 ↑ Dies und das Folgende nach Pierre Crotti: Mesolithikum, in: Historisches Lexikon der Schweiz.
- 26 ↑ Archäologisches Lexikon. Spätpaläolithikum und Mesolithikum in Süddeutschland (etwa 10 000 - 5 000).
- 27 ↑ René Wyss: Das mittelsteinzeitliche Hirschjägerlager von Schötz 7 im Wauwilermoos, Gesellschaft für das Schweizerische Landesmuseum, 1979.
- 28 ↑ René Wyss: Zur Erforschung des schweizerischen Mesolithikums, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 20 (1960) 55-69 (online).
- 29 ↑ B. Bramanti, et al.: Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe's First Farmers, in: Science 326 (2009) 137–140, doi:10.1126/science.1176869.
- 30 ↑ Dies und das Folgende nach Werner E. Stöckli: Neolithikum, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 2010.
- 31 ↑ Detlef Gronenborn: The Persistence of Hunting and Gathering: Neolithic Temperate and Central Europe, in: Vicki Cummings, Peter Jordan, Marek Zvelebil (Hg.): The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers, Oxford University Press, 2014, S. 787-803, hier: S. 791. (Google Books)
- 32 ↑ Dies und das Folgende nach Anthony Denaire, Thomas Doppler, Pierre-Yves Nicod, Samuel van Willigen: Espaces culturels, frontières et interactions au 5ème millénaire entre la plaine du Rhin supérieur et les rivages de la méditerranée, in: Annuaire d'Archéologie Suisse 94 (2012) 21-59.
- 33 ↑ Sankt-Galler Geschichte, 8 Bde, Bd 1: Frühzeit bis Hochmittelalter, St. Gallen 2003, S. 34.
- 34 ↑ Einen Eindruck bietet dieser Filmbeitrag.
- 35 ↑ Beat Eberschweiler: Einbäume aus Zürcher Gewässern, Ulmer Museum 9 (2002) hier: S. 21 (online, PDF).
- 35d ↑ Michael J. Kaiser: Schwarze Steinbeile aus den Vogesen, in: Archäologie in Deutschland 04 | 2017, S. 54 f.
- 36 ↑ J.-L. Voruz: Hommes et Dieux du Neolithique. Les statues-menhirs d'Yverdon, in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 75 (1992) 37–64.
- 37 ↑ Silviane Scharl: Die Neolithisierung Europas – Ausgewählte Modelle und Hypothesen, Würzburger Arbeiten zur Prähistorischen Archäologie 2, Leidorf, Rahden/Westf. 2004.
- 38 ↑ Almut Bick: Die Steinzeit (= Theiss WissenKompakt), Theiss, Stuttgart 2006.
- 39 ↑ P. Moinat, D. Baudais, M. Honegger, F. Mariéthoz: De Bramois au Petit-Chasseur, une synthèse des pratiques funéraires en Valais central entre 4700 et 3800 av. J.-C., in P. Moinat, P. Chambon (Hg.): Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental. Actes du colloque (Lausanne, 12–13 mai 2006). Cahiers d’archéologie romande 110 and Mémoire de la Société préhistorique française XLIII, Lausanne and Paris, S. 297–308, hier: S. 305.
- 40 ↑ Roberto Micheli: Personal ornaments, Neolithic groups and social identities. Some insights into Northern Italy, in: Documenta Praehistorica 39 (2012) 227-255, hier: S. 246.
- 42 ↑ Angela Schlumbaum: Ancient DNA Research on Wetland Archaeological Evidence, in: Francesco Menotti, Aidan O'Sullivan (Hg.): The Oxford Handbook of Wetland Archaeology, Oxford University Press, 2012, S. 569-583, hier: S. 576. (Google Books)
- 43 ↑ Daniela Hofmann: Living by the Lake. Domestic Architecture in the Alpine Foreland, in: Daniela Hofmann, Jessica Smyth (Hg.): Tracking the Neolithic House in Europe. Sedentism, Architecture and Practice, Springer, 2012, S. 197-227, hier: S. 199. (Google Books )
- 43r ↑ Helmut Schlichtherle: Die jungsteinzeitlichen Radfunde vom Federsee und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung, in: Joachim Köninger, M. Mainberger, H. Schlichtherle, M. Vosteen (Hg.): Schleife, Schlitten, Rad und Wagen. Zur Frage früher Transportmittel nördlich der Alpen, Janus-Verlag, 2002, S. 9-34. (Digitalisat, PDF)
- 44 ↑ Ich folge hier Margarita Primas: Bronzezeit, in: Historisches Lexikon der Schweiz und Philippe Della Casa: Switzerland and the Central Alps, in: Anthony Harding, Harry Fokkens (Hg.): The Oxford Handbook of the European Bronze Age, Oxford University Press 2013, S. 706-722 (Google Books).
- 45 ↑ Jakob Heierli: Urgeschichte der Schweiz, Zürich 1901.
- 46 ↑ Alexandra Schmidl, Klaus Oeggl: Subsistence strategies of two hilltop settlements in the Eastern Alps - Friaga/Bartholomäberg (Vorarlberg, Austria) and Ganglegg/Schluderns (South Tyrol, Italy), in: Vegetation History & Archaeobotany 14 (2005) 303-312.
- 47 ↑ Er befindet sich im Musée d'art et d'histoire in Genf.
- 48 ↑ Philippe Della Casa: Switzerland and the Central Alps, in: Anthony Harding, Harry Fokkens (Hg.): The Oxford Handbook of the European Bronze Age, Oxford University Press 2013, S. 706-722, hier: S. 717.
- 49 ↑ Gianna Reginelli, Judit Becze-Deàk, Patrick Gassmann: La Tène revisitée en 2003: Résultats préliminaires et perspectives, in: L'âge du Fer dans l'arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l'âge du Fer. Actes du XXIVe colloque international de l'AFEAF Bienne 5-8 mai 2005, Bd. 2, S. 373-389.
- 50 ↑ Dies und das Folgende nach Biljana Schmid-Sikimić: Hallstattzeit, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 2013.
- 51 ↑ Arnulf Krause: Die Welt der Kelten. Geschichte und Mythos eines rätselhaften Volkes, Campus 2007, S. 70.
- 52 ↑ Verena Geßner: Das hallstattzeitliche Wagengrab von Gunzwil-Adiswil bei Beromünster (Kt. Luzern), in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 39 (1948) 112-122 (online, PDF).
- 53 ↑ Ich folge hier Gilbert Kaenel: Kelten, im Historisches Lexikon der Schweiz, 2008.
- 54 ↑ Julius Cäsar, Bellum Gallicum VI, 14, zitiert In: Felix Müller, Geneviève Lüscher: Die Kelten in der Schweiz. Stuttgart 2004, S. 101.
- 55 ↑ Theodor Mommsen: Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften und Münzen, in: Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 7 (1853) 199–260.
- 56 ↑ Titus Livius: Römische Geschichte. In: Projekt Gutenberg-DE.
- 57 ↑ Paul Gleirscher: Die Räter / I Reti, Verlagsanstalt Athesia, Bozen 1992, S. 12–15.
- 58 ↑ Dies und das Folgende nach: Margarita Primas: Zum Stand der Paläolithforschung in der Schweiz in: Geographica Helvetica 2 (1987) 153-158 (online).
- 59 ↑ Jakob Nüesch: Neue Grabungen und Funde im „Kesslerloch“ bei Thayingen, Kt. Schaffhausen, in: Geschichte und Geographie. Anzeiger für schweizerische Altertumskunde : Neue Folge 2,1 (1900-1901) 4-10 (online).
- 60 ↑ Ich folge hier Regula Frei-Stolba: Römisches Reich, 2012 im Historischen Lexikon der Schweiz.
- 60x ↑ Jürg Rageth Ein spätrömischer Kultplatz in einer Höhle bei Zillis GR, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 51 (1994) 141-172 und Alfred Liver, Jürg Rageth: Neue Beiträge zur spätrömischen Kulthöhle von Zillis : die Grabungen von 1994/95, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 58 (2001) 111-126 (online, PDF).
- 61 ↑ Die Res gestae des Ammiancus Marcellinus.
- 61k ↑ Dies und das Folgende nach Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 4, de Gruyter, 1979, 3. Aufl. 1981, Art. Burgunden, S. 224-271 (Google Books).
- 62 ↑ Uta Heil: Avitus von Vienne und die homöische Kirche der Burgunder, Walter de Gruyter, 2011, S. 6.
- 63 ↑ Uta Heil: Avitus von Vienne und die homöische Kirche der Burgunder, Walter de Gruyter, 2011, S. 18.
- 64 ↑ Einen Überblick nebst Literatur bietet Reinhold Kaiser: Burgunder, in: Historisches Lexikon der Schweiz.
- 65 ↑ Vgl. Renata Windler: Besiedlung und Bevölkerung der Nordschweiz im 6. und 7. Jahrhundert, in: Karlheinz Fuchs (Hg.): Die Alamannen, Theiss, Stuttgart 1997, S. 261–268.
- 65f ↑ Vgl. Sigurd Abel, Bernhard Simson: Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen, Band 1, 2. Auflage, Berlin 1888, S. 141-195 (mit den einschlägigen Quellenbelegen) (online, PDF).
- 66 ↑ Dies und das Folgende nach Reinhold Kaiser: Alemannen (Alamannen), in: Historisches Lexikon der Schweiz, 2002.
- 67 ↑ Warin. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 8, LexMA-Verlag, München 1997, ISBN 3-89659-908-9, Sp. 2049.
- 68 ↑ Widukind, Sachsengeschichte I, 27
- 69 ↑ Wolfgang Giese: Heinrich I. Begründer der ottonischen Herrschaft, Darmstadt 2008, S. 71.
- 70 ↑ Wolfgang Giese: Heinrich I. Begründer der ottonischen Herrschaft. Darmstadt 2008, S. 72.
- 71 ↑ Matthias Becher: Otto der Große. Kaiser und Reich. Eine Biographie, München 2012, S. 92.
- 72 ↑ Gerd Althoff, Hagen Keller: Spätantike bis zum Ende des Mittelalters. Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidierungen 888–1024. (Gebhardt – Handbuch der deutschen Geschichte, 10. völlig neu bearbeitete Auflage), Stuttgart 2008, S. 193.
- 73 ↑ Sarah Thieme: „‚So möge alles Volk wissen‘ – Funktionen öffentlicher Beratung im 10. und 11. Jahrhundert“, in: Frühmittelalterliche Studien 46 (2012) 157–189, hier: S. 169–173.
- 74 ↑ Gerd Althoff: Das Privileg der deditio. Formen gütlicher Konfliktbeendigung in der mittelalterlichen Adelsgesellschaft. In: Otto Gerhard Oexle, Werner Paravicini (Hg.): Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa. Göttingen 1997, S. 27–52; wieder in: Gerd Althoff: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997, S. 99–125; Gerd Althoff: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt 2003, S. 68ff.
- 75 ↑ Dies und das Folgende nach Zähringer. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 9, LexMA-Verlag, München 1998, ISBN 3-89659-909-7, Sp. 463–467.
- 76 ↑ Dagegen: Jürgen Treffeisen: Die Legende vom Zähringerkreuz, in: H. Schadek, K. Schmid (Hg.): Die Zähringer, Bd. 2: Anstoß und Wirkung, Sigmaringen 1986, S. 294-296.
- 77 ↑ Ich folge hier dem Artikel Eidgenossenschaft von Andreas Würgler im Historischen Lexikon der Schweiz.
- 78 ↑ Ausgabe von 1507, Ausgabe von 1752, Google Books.
- 79 ↑ Grundlegend: Sergio Ronchi: Huldrych Zwingli. Il riformatore di Zurigo, Claudiana, Turin 2008 und Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli. Leben und Werk, 3. Aufl., Theologischer Verlag Zürich, 2004, 1. Aufl. Beck, München 1983 (Google Books, Aufl. v. 2004).
- 80 ↑ Vgl. Caroline Schnyder: Reformation und Demokratie im Wallis (1524-1613), von Zabern, 2002.
- 81 ↑ Ich folge hier den Abschnitten von Gaby Knoch-Mund und Robert Uri Kaufmann im Art. Judentum im Historischen Lexikon der Schweiz.
- 82 ↑ Thomas Maissen: Geschichte der Schweiz, Hier + Jetzt, 2010, S. 123–125.
- 83 ↑ Ich folge hier Danièle Tosato-Rigo: Protestantische Glaubensflüchtlinge, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 2012.
- 84 ↑ Fred W. Felix: Die Ausweisung der Protestanten aus dem Fürstentum Orange 1703 und 1711-13, Librairie Droz, Genf/Karlshafen 2000. (Google Books)
- 85 ↑ Wolfgang Friedrich von Mülinen: Vom Äußeren Stand und dem Urispiegel, in: Blätter für Bern. Geschichte, Kunst und Altertumskunde 12 (1916) 1–32, hier: S. 10. Digitalisat.
- 86 ↑ Ich folge hier dem Artikel von Ulrich Im Hof Aufklärung im Historischen Lexikon der Schweiz.
- 87 ↑ Andreas Fankhauser: Helvetische Republik im Historischen Lexikon der Schweiz
- 88 ↑ Joseph Jung (Hg.): Der Bockenkrieg 1804. Aspekte eines Volksaufstands, Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2004.
- 89 ↑ Volker Reinhardt: Die Geschichte der Schweiz. Von den Anfängen bis heute, Beck, München 2014, o. S. (eBook).
- 90 ↑ Ich folge hier, wenn nicht anders vermerkt, den Abschnitten von Robert Uri Kaufmann im Art. Judentum im Historischen Lexikon der Schweiz.
- 91 ↑ Auszug aus der Schweizergeschichte. Nach Karl Dändliker, 5. überarbeitete Auflage, Zürich 1977, S. 179.
- 92 ↑ Pierre Jeanneret: Genfer Unruhen im Historischen Lexikon der Schweiz und Hans-Urs Wili: Eidgenössische Intervention im Historischen Lexikon der Schweiz
- 92d ↑ Dies zeigen die Schwächen von Bernard C. Schär, Béatrice Ziegler (Hg.): Antiziganismus in der Schweiz und in Europa. Geschichte, Kontinuitäten und Reflexionen, Chronos, Zürich 2014.
- 92g ↑ Mauro Cerutti: Weltkrieg, Zweiter, Abschnitt 6: Flüchtlinge im Historischen Lexikon der Schweiz
- 94 ↑ Jürg Fink: Die Schweiz aus der Sicht des Dritten Reiches 1933-1945, Schulthess, Zürich 1985 und Herbert H. Reginbogin: Der Vergleich. Die Politik der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im internationalen Umfeld, LIT-Verlag, 2006 (Google Books).
- 95 ↑ Hans Senn: Weltkrieg, Zweiter, Abschnitt 1.5: Die militärisch betroffene Schweiz im Historischen Lexikon der Schweiz
- 95c ↑ Mauro Cerutti: Weltkrieg, Zweiter, Abschnitt 6: Flüchtlinge im Historischen Lexikon der Schweiz
- 96 ↑ Abkommen von Washington1, Schweizer Gesetzestexte.
- 97 ↑ Ich folge hier den Abschnitten von Jacques Picard im Artikel Judentum im Histosichen Lexikon der Schweiz.
- 98 ↑ Eric Flury-Dasen: Kalter Krieg, Abschnitt 1: Aussenpolitik und Aussenwirtschaft im Historischen Lexikon der Schweiz
- 99 ↑ Statut des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Juni 1945.
- 100 ↑ Marco Jorio: Atomwaffen im Historischen Lexikon der Schweiz
- 101 ↑ Die italienische Immigration, Timeline der SRG SSR idée suisse.
- 102 ↑ Flüchtlinge in der Schweiz: Ein Blick zurück.
- 103 ↑ Statistik Schweiz.
- 104 ↑ Aktuelle Ergebnisse, Bundesamt für Migration.
- 105 ↑ „Schweiz wächst rekordschnell“, Medienmitteilung des BFS vom 26. Februar 2009, auf www.swissinfo.ch.
- 106 ↑ Weniger Deutsche, mehr Südeuropäer, in: Neue Zürcher Zeitung, 9. Juli 2014.
- 107 ↑ In die Schweiz eingereiste Ausländer nach Einwanderungsgrund, 5.2013 -4.2014, Bundesamt für Migration.
- 108 ↑ Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung nach Wohnkanton und Ausländergruppe Ende April 2014, Bundesamt für Migration.
- 109 ↑ museums.ch. Die Plattform der Museen in der Schweiz. Dank der sogenannten „Museumslupe“ kann man nach einfachen Kriterien oder gezielt nach Museen suchen (Museen finden).
- 110 ↑ Spezial-Bibliotheken auf bibliothek.ch.
- 111 ↑ Schweizer Virtueller Katalog.
- 112 ↑ Gilbert Coutaz, Rodolfo Huber, Andreas Kellerhals, Albert Pfiffner, Barbara Roth-Lochner (Hg.): Archivpraxis in der Schweiz/Pratiques archivistiques en Suisse, Bern 2007.
- 113 ↑ Otto Sigg: Die Archive der Kantone, 2005.
- 114 ↑ Archivsuche.
- 115 ↑ archaeologie.ch bietet die für das Land bedeutenden Einrichtungen, vor allem die Kantonsarchäologien.
- 115c ↑ Pascal Germann: Laboratorien der Vererbung. Rassenforschung und Humangenetik in der Schweiz 1900-1970 , Wallstein, Göttingen 2016, S. 168.
- 115f ↑ archaeologie-schweiz.ch.
- 116 ↑ Digitalisate
- 117 ↑ Digitalisate
- 118 ↑ Digitalisate
- 119 ↑ Website
- 120 ↑ Rezension
- 120c ↑ Rezension
- 121 ↑ L'histoire c'est moi.
- 122 ↑ Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG)
Für die Abbildungen gilt:
Kopieren, Verbreiten oder Modifizieren ist unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, erlaubt. Eine Kopie des Lizenztextes ist unter dem Titel GNU Free Documentation License enthalten.
Der Text findet sich hier.